Was Maximilian Krah einer italienischen Zeitung über die Waffen-SS sagte, war unter deutschen Spitzenpolitikern einst Gemeingut. Ob Adenauer, Schumacher, Strauß oder Schmidt – sie alle weigerten sich, die Truppe pauschal zu verdammen. Wie es wirklich war, erfahren Sie hier.
Bitburg am 5. Mai 1985: Bundeskanzler Helmut Kohl und sein Staatsgast, der amerikanische Präsident Ronald Reagan, legen auf dem Soldatenfriedhof der pfälzischen Stadt einen Kranz zum Gedenken an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten nieder und reichen sich die Hand. Wenig später bricht ein Sturm der Entrüstung los.
Der Grund: Auf dem Gottesacker liegen neben zahlreichen Soldaten der Wehrmacht auch 43 Angehörige der Waffen-SS begraben. Im Blätterwald rauscht es gewaltig, viele Gazetten werfen CDU-Kanzler Kohl und Reagan eine Verharmlosung des Nazi-Regimes und „Rehabilitierung“ der SS vor.
Ganz vorne mit dabei war der Leitphilosoph der BRD-Linksliberalen. Unter dem Titel „Die Entsorgung der Vergangenheit“ schrieb Jürgen Habermas in der Zeit: „Der Händedruck von Bitburg hätte also beides verschmelzen sollen – die Abkehr von einer destabilisierenden Vergangenheitsbewältigung und die Bezeugung aktueller Waffenbrüderschaft. Kohl wollte die Rückkehr zu deutschen Kontinuitäten.“
Grass – mit Doppel-S
Ein anderer Kritiker ist Günter Grass. Der Literat attestierte Kohl „Geschichtsklitterung“ und warf dem Kanzler vor, „Unschuldszeugnisse“ ausstellen zu wollen. Seiner Meinung nach spreche „Unwissenheit nicht frei. Sie ist selbst verschuldet, zumal die besagte Mehrheit wohl wusste, dass es Konzentrationslager gab (…). Kein selbstgefälliger Freispruch hebt dieses Wissen auf. Alle wussten, konnten wissen, hätten wissen müssen.“
Grass‘ damalige Wortmeldung und seine unzulässige Gleichsetzung von kämpfenden Einheiten (Waffen-SS) mit den Vollstreckern der KZ-Barbarei sollte Jahrzehnte später auf ihn zurückfallen, als 2006 bekannt wurde, dass er – der bei den Bewältigungsorgien stets mitmachte und mit Vorwürfen an andere aufgrund deren NS-Vergangenheit nicht geizte – selbst der verfemten Truppe angehörte.
Auf einmal stellte sich der Literatur-Nobelpreisträger als „typischen Vertreter seiner Generation“ dar, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Das Antibürgerliche am Nationalsozialismus sei entscheidend für die Mobilisierung seiner Generation gewesen. Von der Waffen-SS will er gewusst haben, dass sie als Eliteeinheit galt, in der es hohe Verluste gab. Auf die symbolische Bedeutung der SS-Abzeichen sei er erst aufmerksam geworden, als seine Division aufgerieben war und sein Vorgesetzter ihm befahl, die Uniform zu wechseln.“
„Meine Hochachtung“
Bitburg und der Grass-Skandal waren quasi Vorläufer der aktuellen Kampagne gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah wegen dessen differenzierter Sicht auf die jüngere deutsche Vergangenheit respektive die Waffen-SS. Dabei war das, was Krah sagte, noch vor wenigen Jahrzehnten Allgemeingut hochrangiger deutscher Politiker.
Gegenüber dem, was Franz-Josef Strauß über die Soldaten mit Totenkopf auf der Feldmütze bemerkte, nehmen sich die Äußerungen Krahs sogar geradezu harmlos aus. Der für seine klare Sprache bekannte spätere Ministerpräsident von Bayern erklärte am am 21. März 1957 in einem Brief an den Veteranenverband HIAG:
„Wie ich persönlich über die Leistungen der an der Front eingesetzten Verbände der Waffen-SS denke, wird Ihnen bekannt sein. Sie sind selbstverständlich in meine Hochachtung vor dem deutschen Soldaten des letzten Weltkrieges eingeschlossen.“
Damit lag der CSU-Mann auf einer Linie mit Bundeskanzler Konrad Adenauer, der in seine Ehrenerklärung für die deutschen Frontsoldaten, die er 1952 vor dem Bundestag abgab, ausdrücklich jene der Waffen-SS mit einbezog. Einen bezeichnenden Satz schob er später nach:
„Ich weiß schon längst, dass die Soldaten der Waffen-SS anständige Leute waren. Aber, solange wir nicht die Souveränität besitzen, geben die Sieger in dieser Frage allein den Ausschlag, so dass wir keine Handhabe besitzen, eine Rehabilitierung zu verlangen.“
Einen ähnlichen Blick auf die Soldaten in Erbsentarn hatte auch Adenauers großer Kontrahent, der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher, der von den Nazis jahrelang in verschiedene KZs gesperrt worden war. Er äußerte 1952, „er habe keine Vorbehalte gegenüber den Zusammenschlüssen ehemaliger SS-Angehöriger und lehne auch in Bezug auf die SS jede ‚Kollektivschuld‘ ab“, wie der Militärhistoriker Jens Westemeier feststellte.
Im Bundestag erklärte Schumacher: „Die Waffen-SS ist als eine Art vierter Wehrmachtteil geführt worden und als Massenformation (…) für Kriegszwecke geschaffen worden.“
Keine Kollektivschuld
Deutlich gegen eine kollektive Verdammung der deutschen Frontsoldaten sprach sich auch Altkanzler Helmut Schmidt aus. 2008 erklärte er in einem Interview mit Ulrich Wickert für die Welt:
„Ich bin der Meinung immer gewesen, dass es keine kollektive Schuld gibt, immer nur die Schuld der Person und nicht einer Masse. Ich muss hinzufügen, es gibt auch keine kollektive Ehre. Viele ehemalige Berufssoldaten haben in jenen Jahren von der Ehre des deutschen Soldaten geredet. Dem hab ich immer widersprochen.“
Auch der SPD-Mann sollte wenig später selbst ins Visier der Vergangenheitsbewältiger geraten. Schmidt hatte im Zweiten Weltkrieg als Offizier der Wehrmacht gedient und war mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet worden.
Verschiedene Historiker und Journalisten warfen ihm eine angebliche Regimenähe vor, da er als Soldat gute Beurteilungen von seinen Vorgesetzten erhalten hatte. Das Schmidt-Porträt in Uniform in der Bundeswehr-Uni Hamburg sollte im Giftschrank verschwinden.
Die Beispiele zeigen: Noch vor wenigen Jahrzehnten war es selbst für deutsche Spitzenpolitiker noch normal, in Bezug auf die SS zu differenzieren und die kämpfende Truppe, also die Waffen-SS, von der sogenannten schwarzen SS zu unterscheiden. Wie man auch immer bewerten mag, dass er ausgerechnet im Europawahlkampf zu diesem Thema Stellung bezogen hat: skandalös sind seine Äußerungen überhaupt nicht.
Lesen Sie, wie es wirklich war: In „Veteranen der Waffen-SS berichten“ treten Zeitzeugen und alte Kämpfer den Lügen und der Hetze entgegen. Jetzt notwendiger denn je! Hier bestellen.



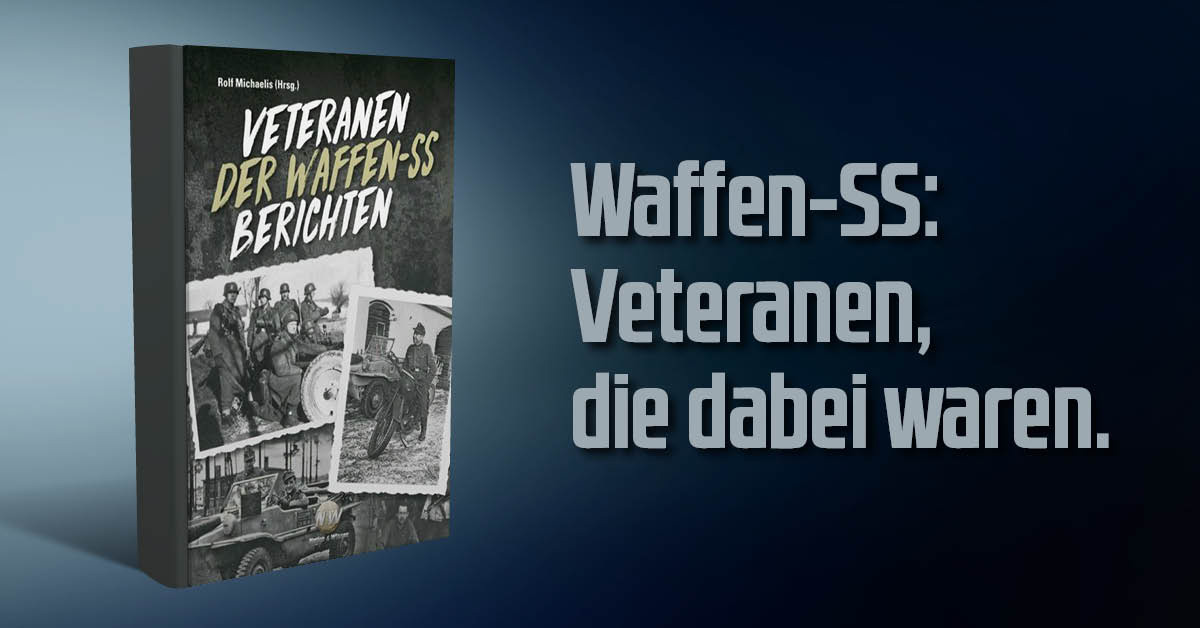
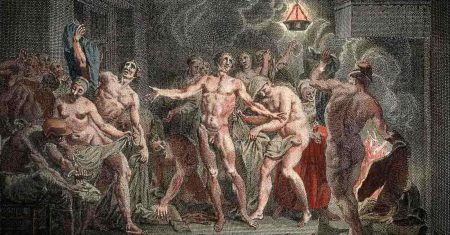


5 Kommentare
Und heute hat die CSU Söder. Was für ein Trauerspiel.
Erinnert sei an das Buch "Ich war dabei" von dem ehem. Redakteur des Bayrischen Rundfunks, Franz Schönhuber, es hat damals schwer Furore gemacht. Schönhuber wurde gekündigt, dann gründete er die Partei "Die Republikaner".
Franz Josef Strauß war seinerzeit bei öffentlichen Auftritten lautstarkem Terror roter Brüllaffen ausgesetzt, die er ausdrücklich als Berufsdemonstranten entlarvte. Er wusste sich zudem mit sehr starken Lautsprecheranlagen zu wehren.
Allmählich geht mir dieses unnütze Dauerschleife Wiederrholungs-Thema auf den Sack. Es gibt aktuell 1000 wichtigere, sehr dringendere Themen. Den DEXIT zum Beispiel – und nicht die s.g. "Wahl" von Leuten in einer unnützen EU-Quatschbude, die REIN GAR NICHTS entscheiden oder verändern können.
Über die immense deutsche Schuldknechtschaft der öffentlichen Hände, der Unternehmen und vieler einzelner Bürger redet kein "Volksvertreter", egal welches Farbetikett er trägt. Wen vertreten diese Volksvertreter? Ausländische Banken?
Zur Ablenkung werden nachrangige oder unsinnige Themen hochgespielt oder gar vorsätzliche Krisen inszeniert. Hätte Maximilian Krah die Schuldknechtschaft thematisiert, hätte er sozusagen in ein Wespennest gestochen und mit dem Setzen eines echten Skandalthemas alle zustimmende und ablehnende Aufmerksamkeit, auch Italiens und Frankreichs, positiv auf sich gelenkt, zum Missfallen der entlarvten Hintergrundmächte.