Vor drei Jahren, in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 2017, verstarb der Publizist Hans-Dietrich Sander nach langer, schwerer Krankheit. Der frühere Mitarbeiter des berühmten Dramatikers Bertolt Brecht am Berliner Ensemble, zeitweilige Feuilletonist der Welt und spätere Herausgeber der Zeitschrift Staatsbriefe war ein origineller Querdenker – und nahm für seine patriotischen Überzeugungen viele Nachteile in Kauf. COMPACT empfiehlt seine wichtigsten Aufsätze zu Volk, Staat und Nation.
Ein derart bewegtes Leben voller – auch politischer – Brüche findet man selten. Und es begann im hohen Norden: Hans-Dietrich Sander wurde am 17. Juni 1928 in Grittel bei Ludwigslust in Mecklenburg geboren und zählt damit zur sogenannten Generation der Flakhelfer. Als junger Marineassistent in Kiel musste er schwere Luftangriffe auf dicht besiedelte Stadtviertel miterleben, in seine Erinnerungen gruben sich die lichterloh brennenden Straßenzüge und die Erfahrung, nur knapp dem Tod entronnen zu sein, tief ein. Obgleich Hitlerjunge, empfand er für den Nationalsozialismus wenig Sympathien. „Rassenhass und Völkerverachtung“ erschienen dem Sohn eines aus Thüringen stammenden Reichsbahnbeamten und einer Mutter aus einer brandenburgischen Dachdeckerfamilie „abwegig“.
Am Berliner Ensemble

„Der Nachkrieg mit seinen Vorurteilen und Ressentiments“, so Sander im Jahr 1958, „warf mich auf das geschmähte Christentum zurück“. So begann er 1948 ein Studium der evangelischen Theologie im damals unter Blockade stehenden West-Berlin. Schon ein Jahr später schrieb er sich an der Freien Universität für Theaterwissenschaft und Germanistik ein, weil dies seinen Neigungen eher entsprach. Durch die Vermittlung von Herbert Ihering, zu Weimarer Zeiten führender Theaterkritiker in Deutschland und nach dem Krieg Chefdramaturg am Deutschen Theater, konnte der junge Student bei den Proben des Berliner Ensembles von Bertolt Brecht in Ost-Berlin hospitieren und wandte sich durch die Bekanntschaft mit dem berühmten Dramatiker fortan immer stärker dem Marxismus zu. Im Jahr 1952 zog Sander schließlich in den Ostteil der Stadt. Brecht vermittelte ihm eine Stelle als Dramaturg im Bühnenvertrieb des Henschel-Verlags. Nebenbei schrieb er Kritiken für die Zeitschrift Theater der Zeit, die sein Mentor am Berliner Ensemble einmal als die besten der DDR bezeichnen sollte.
Sanders Sympathien für den Kommunismus begannen an seinem 25. Geburtstag, dem 17. Juni 1953, zu schwinden, als Volkspolizei und Sowjetpanzer den mitteldeutschen Volksaufstand niederschlugen. In den Westen siedelte er, nun vom Marxismus restlos geheilt, 1957 wieder über, um ein Jahr später nach Hamburg zu ziehen und dort als Feuilleton-Redakteur bei der Tageszeitung Die Welt anzufangen. Deren Chefredakteur war seinerzeit Hans Zehrer, der in der Weimarer Republik mit der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Die Tat zu den einflussreichsten Publizisten aus dem Umfeld der Konservativen Revolution gehört hatte.
Bei Hans Zehrers Welt

Schon kurz nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik meinte Sander, bei vielen Landsleuten eine Mentalität festzustellen, die er in einer autobiografischen Skizze, die sein 1980 erschienenes Buch Der nationale Imperativ beschließt, wie folgt zusammenfasste: „Wir sind zu allem bereit, wenn man uns nur in Ruhe lässt“. Insbesondere der Opportunismus der Nie-Dabei-Gewesenen stieß ihn ab, doch ebenso das, was Gustaf Gründgens einmal „Bundesmasochismus“ nannte. Jenem Phänomen widmete Sander auch seinen Debütartikel in der Welt vom 22. Februar 1958. Ansonsten konzentrierte er sich auf Literatur und Philosophie. Sander schrieb über Bloch und Lukács, Heidegger und Jünger, Céline und Pound. Ein Walter Jens witterte schon damals Unheil – weitere Nachstellungen sollten folgen.
In zwei Phasen, zwischen 1958 und 1962 und von 1965 bis 1967, konnte der unbequeme Journalist bei der Welt wirken, was vor allem der schützenden Hand Zehrers zu verdanken war, der es begrüßte, dass Sander seine Artikel politisch immer weiter zuspitzte. Dass sein Schützling am Ende doch seinen Hut nehmen musste, lag weniger an Axel Springer, der, wie Sander einmal erklärte, durchaus bereit gewesen wäre, ihn zu halten, als vielmehr an der Intervention von Zehrers Stellvertreter Ernst Cramer. Auch die Fürsprache des berühmten Politikwissenschaftlers Ernst Fraenkel, damals Direktor des John-F.-Kennedy-Instituts für Nordamerikastudien der FU Berlin, konnte Sander schlussendlich nicht helfen.
Mit Sanders Fortgang bei der Welt begann für den „nationalen Dissidenten“ – so die Bezeichnung des politischen Denkers im Untertitel einer Festschrift zu seinem 80. Geburtstag – ein neuer Lebensabschnitt. 1969 promovierte er bei Hans-Joachim Schoeps in Erlangen mit der Studie Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie, in der er das denkerische Erbe von Karl Marx von der Dogmatik des Marxismus-Leninismus befreite. Sander würdigte Marx als einen wichtigen Philosophen des Industrialisierungsprozesses und frühen Empiriker der kapitalistischen Produktionsweise, verwarf jedoch dessen deterministisches Geschichtsbild und verwies auf die gegenüber der Mitte des 19. Jahrhunderts veränderten gesellschaftlichen Konstellationen, die den Marxismus als untauglich zur Lösung aktueller Fragen erscheinen ließen.
„Nationaler Imperativ“
Im Jahr 1972 erschien dann Sanders kanonische Geschichte der Schönen Literatur in der DDR, die Hans Dieter Zimmermann, Professor am Institut für Literaturwissenschaft der TU Berlin, im Jahr 2000 in seiner eigenen Arbeit über die Literatur des geteilten Deutschlands als „die beste Untersuchung über die Literatur der DDR“ bezeichnete. Ansonsten fand das Werk nicht die Beachtung, die es verdient hätte. Es wurde sogar eine neuerliche Kampagne gegen Sander losgetreten, in deren Folge der Rombach-Verlag das Buch aus dem Vertrieb zurückzog. Der Autor selbst erklärte dies einmal so: „Ich verstieß gegen die Theorie von den zwei deutschen Literaturen und prangerte die Romantik nicht als Vorwegnahme der deutschen Daseinsverfehlung an.“ Eine der wenigen positiven Rezensionen kam von Ernst Kantorowicz, der in Ausgabe 1/1974 des Deutschland-Archivs Sanders Darstellung im Wesentlichen bestätigte.
Mit dem Buch Der nationale Imperativ erschien dann 1980 im konservativen Sinus-Verlag, wo auch der frühere CDU-Politiker und Berliner Innensenator Heinrich Lummer veröffentlichte, eine Sammlung politischer Essays, in der Sander neue Texte mit Beiträgen, die zuvor in Caspar von Schrenck-Notzings Zeitschrift Criticón und anderen Publikationen erschienen waren, verknüpfte und für ein neues Nationalbewusstsein warb. Als Chefredakteur der Deutschen Monatshefte von 1983 bis 1986 und schließlich als Herausgeber der Staatsbriefe von 1990 bis 2001 setzte er diese publizistische Arbeit unbeirrt fort.
Ghibellinische Tradition
Der Titel der monatlich erscheinenden Staatsbriefe bezog sich auf die gleichnamigen Erlasse des Stauferkaisers Friedrich II. Der Umschlag, wie das ganze Heft sehr schlicht gehalten, zeigte auf der Vorderseite ein Oktagon auf grauem Grund, den Grundriss des apulischen Castel del Monte des römisch-deutschen Herrschers. In Friedrich II. sah Sander den Kaiser der deutschen Sehnsucht, dem es gelang, binnen weniger Jahre das sizilische Chaos zum Staat zu bändigen, die Einmischung des Papstes in innere Angelegenheiten zu beseitigen, die Macht der Verbündeten Roms zu brechen und ein straffes, nur ihm verantwortliches Beamtenkorps zu schaffen. Sander vermutete sogar, dass Europa das Zeitalter der konfessionellen Konflikte erspart geblieben wäre, wenn sich Friedrich II. und die staufische Dynastie länger hätten halten können.

Die Ära der Staufer galt als fester Bezugspunkt im politischen Denken Sanders. Im Genius Friedrich II. bündelte sich für ihn all das, was seiner Ansicht nach auch in der Gegenwart dazu dienen könnte, die Zerfallsprozesse aufzuhalten, nämlich die Fähigkeit zur Repräsentation, juristische Formkraft und die Möglichkeit zur Dezision, die politisch-theologischer Souveränität entspringt. Wo dies fehle, wächst für Sander die Gefahr der Staatsverfehlung, die sich in den verschiedenen Formen des Totalitarismus der Moderne gezeigt habe – und hierzu rechnet er auch den Liberalkapitalismus angelsächsischer Prägung, da er ebenso wie Kommunismus und Nationalsozialismus das Ganze von einem Teil her definiere, woraus eine begrenzte Sichtweise resultiere, mit der keine dauerhafte Herrschaft begründet werden könne.
Sanders Vermächtnis
Mit seinem Rekurs auf den Stauferkaiser Friedrich II. und die „ghibellinische Idee“ (Johann Gustav Droysen) wirkte der Publizist Hans-Dietrich Sander wie aus der Zeit gefallen. Weniger zugeneigten Rezipienten erscheint die Beharrlichkeit und Verve, mit der Sander diesen Gedanken seit Jahrzehnten vertritt, mitunter spleenig, seine Anhänger sehen darin einen besonderen Ausweis seiner Originalität und Tiefgründigkeit, für ihn selbst ist die Rückbesinnung auf die staufischen Reichsidee nicht weniger als eine „Existenzfrage“ des deutschen Volkes und eine geopolitische Notwendigkeit, die sich aus der Mittellage Deutschlands in Europa ergibt.
Der Arnshaugk-Verlag (Neustadt an der Orla) hat die verdienstvolle Aufgabe übernommen, Sanders wichtigste Texte aus dreißig Schaffensjahren in zehn Bänden zu veröffentlichen. In dieser von Heiko Luge unter dem von T.S. Eliot entlehnten Motto „Style and Order“ herausgegebenen Reihe ist auch das Buch Der ghibellinische Kuss erschienen. Darin schlägt Sander einen Bogen vom Ghibellinentum Kaiser Friedrich II. in die heutige Zeit.
Im Prolog zum Ghibellinischen Kuss schreibt Sander: „Friedrich II. verband Okzident und Orient. Er gab der deutschen Ostkolonisation die wesentlichen Impulse, als er Hermann von Salza mit dem Deutschen Ritterorden in das spätere Ostpreußen schickte. Der Staat, der ihm vorschwebte, sollte des Reiches Kern sein. Er schuf mit den ‚Konstitutionen von Melfi‘ die moderne Verwaltungskunst – das einzige, was den Deutschen nach ihren Niedergängen heute noch geblieben ist.“
Und er fährt fort: „Friedrich II. war radikal und weltoffen, wie Herbert Cysarz den deutschen Geist einmal bezeichnet hat. Mit der Niederhaltung der anmaßenden Macht des Heiligen Stuhls setzte er die religiöse Toleranz im Reiche durch. Er vertrat eine Form des Christentums, die ihn für den Heiligen Stuhl als einen deutschen Ketzer erscheinen ließ, wie er nach ihm nur noch in der Gestalt Luthers bekämpft wurde.“
„Das Reich als politische Einheit der Deutschen“
Nach Sanders Ansicht setzte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation das alte Imperium Romanum zwar nicht geographisch, sehr wohl aber geschichtlich fort, auch in seiner eschatologischen Funktion als Katechon, wie der Autor mit Carl Schmitt bemerkt. „Aus dieser Sukzession entsprang neben der Objektivität und dem national-universalen Ansatz eine dritte wesentliche Reichskomponente, die den faustischen Trieb der Germanen, der so oft zu Selbstzerstörung und Selbstverlust geführt hatte, zu einem Konstruktionsfaktor veredelte. Sie bestand aus dem römisch-christlichen Anteil, der fruchtbaren Verbindung von Pax Romana und Pax Christiana, die mit der germanischen Substanz zu einer neuen Größe eigener Art verschmolz“, heißt es in Sanders Aufsatz „Das Reich als politische Einheit der Deutschen“ im Sammelband Der ghibellinische Kuss.
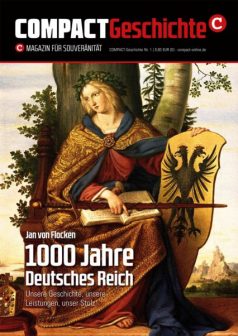
Sander sieht mit Droysen in dem Wettstreit zwischen der ghibellinischen und der guelfischen Staatsauffassung einen Grundkonflikt in der deutschen Geschichte seit den Zeiten der Auseinandersetzungen zwischen Friedrich und dem Welfenkaiser Otto IV., den der Staufer 1218 für sich entscheiden konnte. Das Guelfische, die Idee „der Landesherrlichkeit territorialer Abschließung“, wie Sander schreibt, ist nach diesem Verständnis der Widerpart des Ghibellinentums, mit „imperialer, hegemonialer Geste“ stets über den reinen Territorialstaat hinausdachte, ohne andere Länder zu unterdrücken, sondern in der kultivierten Form „einer repräsentativen Führung, (…) in der sich das Fremde vertreten fühlen kann“. Dies – Herrschaft statt Machthabe – sei laut Sander „der Kern der ghibellinischen Idee, die zu den bewundernswürdigsten Schöpfungen der menschlichen Geschichte gehört“, wie er in seinem Aufsatz „Die ghibellinische Idee“ schreibt.
In seinem Aufsatz „Der ghibellinische und der guelfische Typus in der deutschen Geschichte“ führt Sander zu dieser Dichotomie näher aus: „Der eingefleischte Gegensatz wurde im 12. Jahrhundert erstmals benannt. Ghibellinen hießen die Anhänger der Staufer und Guelfen die Parteigänger des Vatikans, dessen politischen Gelüsten das Deutsche Reich immer ein Pfahl im Fleisch geblieben ist.“ Im Nibelungenlied werde der Gegensatz von Siegfried und Hagen idealtypisch repräsentiert, im Zwist zwischen Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen habe er sich erstmals real zugespitzt, später sei die ghibellinische Idee zum „Träger der Reichsidee“ als einer „politischen Einheit, deren deutscher Kern andere Stämme und Völkerschaften in der Dialektik von Schutz und Gehorsam um sich versammelte“, geworden.
Der guelfische Typus, etwa vertreten durch das Haus Habsburg, sei hingegen immer „reichsunwillig und reichsunfähig“ und „von der Neigung zu Hinterhalt und Verrat“ gezeichnet gewesen. „Sein politischer Horizont war begrenzt von Territorialstaats- und Hausmachtspolitik“, so der Autor. Erst mit dem Großen Kurfürsten, den der Wiener Hof als „Hunnen an der Ostsee“ verhöhnt habe, sei eine Renaissance der ghibellinischen Idee in der Mark Brandenburg eingeleitet worden, die später in der preußischen Staatsidee mündete. Sander würdigt dies mit den Worten: „Mit der ghibellinischen Renaissance wurde Preußen zur Polis der Neuzeit, weil es alle ihre Probleme in der Volksbildung, in der Verwaltung, in der Wirtschaft und im Sozialgefüge mustergültig löste – als eine Symbiose von Athen und Sparta.“
„Reichsersatzideologie“ der EU
In der heutigen EU erkennt Sander bestenfalls eine „Reichsersatzideologie“, aber keinesfalls einen Ersatz für die ghibellinische Idee. In einem Aufsatz jüngeren Datums mit dem Titel „Europa ohne Maß und Macht“ führt er dazu aus: „Brüssel zerstörte sukzessive die nationalen volkswirtschaftlichen Kreisläufe, indem es die Produktionsstandorte allein aufgrund von Rentabilität und Profit ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl auswählte. Trotz aller Einbildungen und Rattenfängermelodien wurde die von der alten D-Mark gewährleistete Geldstabilität in kürzester Zeit verspielt. Mit dem Bologna-Prozess sackte das Erziehungswesen samt Volksbildung ab – von den Universitäten bis zum Handwerk. (…) Umso drastischer fällt heute die Ernüchterung aus. Im Zuge der Euro- und Flüchtlingskrise brechen nun die künstlich unterdrückten nationalen Interessen wieder hervor, und die fast schon weggedämmerten Völker erwachen langsam wie aus einem bösen Traum. Sie fühlen sich von verantwortungslosen Politikern hinters Licht geführt. Man hatte sie mit einer Verschiebung von Bedeutungen und einem Austausch von Begriffen semantisch getäuscht und auf einen Weg gelockt, den sie gar nicht einschlagen wollten.“
In seinen letzten Jahren lebte Sander zurückgezogen im Brandenburgischen, hielt sich jedoch stets auf dem Laufenden, was die politische Lage anbelangt – und wahrte dabei seine innere Distanz zu den Herrschenden und das von ihnen repräsentierte System. Seine wichtigsten Gedanken zu Volk, Staat und Nation sind in dem Werk Der ghibellinische Kuss zusammengefasst. Das Buch eignet sich hervorragend als Einstiegslektüre und kann HIER bestellt werden.






