Wer waren eigentlich unsere Vorfahren? Kaum ein Volk übt bis heute eine so ungebrochene Ausstrahlung aus wie die Germanen. Dr. Stephanie Elsässer sprach darüber mit dem Historiker Jan von Flocken. In unserer Sonderausgabe „Die Germanen – Die Geschichte der ersten Deutschen“ lesen Sie Wahrheit über den Freiheitskampf unserer Ahnen, ihre Kultur und ihre Bedeutung für die Herausbildung unserer Nation. Hier mehr erfahren.
Elsässer: Wir sind bei Jan von Flocken, dem bekannten Historiker und Preisträger. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, und wir wollen heute mit ihm über unsere neue Geschichtsausgabe „Die Germanen: Die Geschichte der erstsen Deutschen“ sprechen. Es geht hier im Heft mit der Frühzeit los. In Europa lebten die Kelten, die Slawen und Germanen. Wir erfahren von ihren Heiligtümern wie den Externsteinen, von ihren Festen, von den Wikingern, von den germanischen Stämmen, von der Himmelsscheibe von Nebra, die eine hochstehende Kultur in der Bronzezeit beweist, wir erleben die germanischen Götter wie Thor und Odin, wir erfahren von der Irminsul, von der Schrift, den Runen, von ihren Kriegen und vielem mehr. Lieber Jan von Flocken, die erste Frage: Unsere Germanenausgaben sind ja Bestseller. Was fasziniert die Menschen heute noch an den alten Germanen?
von Flocken: Das frage ich mich manchmal auch. Es ist ja im besten Deutschland aller Zeiten, wie unser hochverehrter Herr Bundespräsident sagt, Konsens, unsere Geschichte mit Dreck zu beschmieren oder sie auf zwölf Jahre zu reduzieren. Ich kann mir das nur so erklären, dass gerade weil die deutsche Geschichte offiziell so mies gemacht wird, es Menschen gibt, die sagen, sie möchten mal wissen, wie es wirklich gewesen ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch an unseren Urvätern, wenn man so sagt, den Germanen, ein profundes Interesse besteht. Ich freue mich darüber und wundere mich gleichzeitig auch ein bisschen.

Elsässer: Würden Sie denn auch sagen, dass die Germanen das prägende Volk in Europa waren, neben den Kelten und Slawen, stimmt das?
von Flocken: Prägend schon mal, was die Sprache angeht; vom Angelsächsischen über das Skandinavische bis zum Deutschen hat sich das Germanische erhalten. Das Keltische wird ja kaum noch gesprochen, das Slawische eher, aber das kam viel später. Auch die Slawen, nehmen wir mal Russland; „Rus“ ist ein germanisches Wort und bedeutet „Ruderer“. Also die Kiewer Rus, das Urrussland, ist germanisch geprägt, auch wenn man das dort nicht so gerne hört. Also insofern stimmt das schon, dass die Germanen bis heute, wie man sagen kann, die prägende Volksgruppe für Europa sind.
Elsässer: Was wir eben angeschnitten haben, habe ich mir mal ein Zitat herausgeschrieben, weil heute einige Politiker und Kulturschaffende behaupten, die Germanen hätten es gar nicht gegeben, sie seien ein Konstrukt. Das sagt zum Beispiel Naika Foroutan, Tochter eines Iraners und Leiterin des Berliner Instituts für Integrations- und Migrationsforschung. Ich kann mir nicht erklären, warum die alten Germanen heute gerne mal verleugnet werden. Was glauben Sie, was der Grund dafür sein könnte?
von Flocken: Ja gut, was die Dame aus Mittelasien zu ihrem Urteil veranlasst hat, kann ich nicht sagen, das muss sie selbst wissen. Richtig ist, insofern, als wenn man vor ungefähr 2.000 Jahren einem Cherusker, einem Chatten, einem Sueben, einem Alemannen gesagt hätte, du bist ein Germane, hätte der sich sehr gewundert, weil dieser Ausdruck eine Erfindung der Römer ist, die alles, was jenseits des Rheins war, als die Germanen subsumiert haben, insbesondere der berühmte Tacitus in seiner Germania.

Als solche haben die sich natürlich nicht gesehen, ebenso wenig wie die Gallier, die von Caesar zu Galliern gemacht wurden. Auch ein Arverner oder ein Veneter oder ein Veneller hätten sich des Todes gewundert, dass er ein Gallier sei. Insofern ist es richtig, dass dieser Begriff „Germanen“ eine Fremdbestimmung der Römer war.
Aber, ich habe ja schon die Gallier als Beispiel genannt, auch die Griechen, den Ostgriechen gab es zwar, aber ein Makedonier hätte eigentlich mit einem Spartaner und der mit einem Athener auch nicht so sehr viel gemeinsam gehabt. Also haben wir das bei vielen Völkern der Antike, dass sie einen subsumierenden Namen haben, der, was die einzelnen Stämme angeht, nicht hundertprozentig stimmt.
Elsässer: Ja, die Germanen waren ein Volk mit hunderten Stämmen. Was glauben Sie, was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Stamm oder welche waren die wichtigsten Stämme?
von Flocken: Natürlich nicht die Cherusker, das ist klar, das kennt man ja von Hermann, der eigentlich Arminius hieß. Den wichtigsten Stamm festzustellen ist schwierig; wir könnten das ganz zum Schluss noch einmal behandeln, was so Sachsen und Alemannen angeht. Was ich ganz kurios fand, es gab Ende der 80er Jahre ein Manöver in der Bundeswehr, das „Standhafte Chatten“ hieß. Und überall taucht es auf als „Standhafte Schatten“, weil keiner mehr wusste, dass die im heutigen Hessen lebenden Stämme der Germanen unter dem Begriff „Chatten“ mit „Ch“ zusammengefasst sind.
Das zeigt also, dass da einiges an Wissen verloren gegangen ist und dass es dann ganz schwierig ist zu sagen, wer der bedeutendste war. Aber wir können gerne noch zum Schluss auf Sachsen und Alemannen zu sprechen kommen, dann werden wir schon sehen, wer aus meiner Sicht die bedeutendsten sind.
Elsässer: Sie haben schon die Cherusker angesprochen. Jetzt kommen wir zu den Herausforderern des römischen Imperiums, den Befreiern Germaniens, eben einmal Arminius, Hermann der Cherusker, Varusschlacht im 9. Jahrhundert nach Christus, und es gab noch einen weiteren Befreiungskämpfer namens Marbod. Und die beiden haben ja leider nicht zusammengefunden, warum eigentlich?
von Flocken: Das ist ein Familienzwist von shakespearischem Ausmaß, kann man schon sagen. Es ist sehr schade, dass unsere großen deutschen Dramatiker Schiller, Goethe und Lessing sich dieses Themas nicht angenommen haben. Da ist alles drin, was zum Beispiel Shakespeare in seinen Tragödien von der ersten Titus Andronicus bis zur letzten, man kann schon etwas respektlos sagen, verwurstet hat an Animositäten zwischen Mann und Frau, zwischen Vater und Sohn, zwischen Bruder und Schwester.
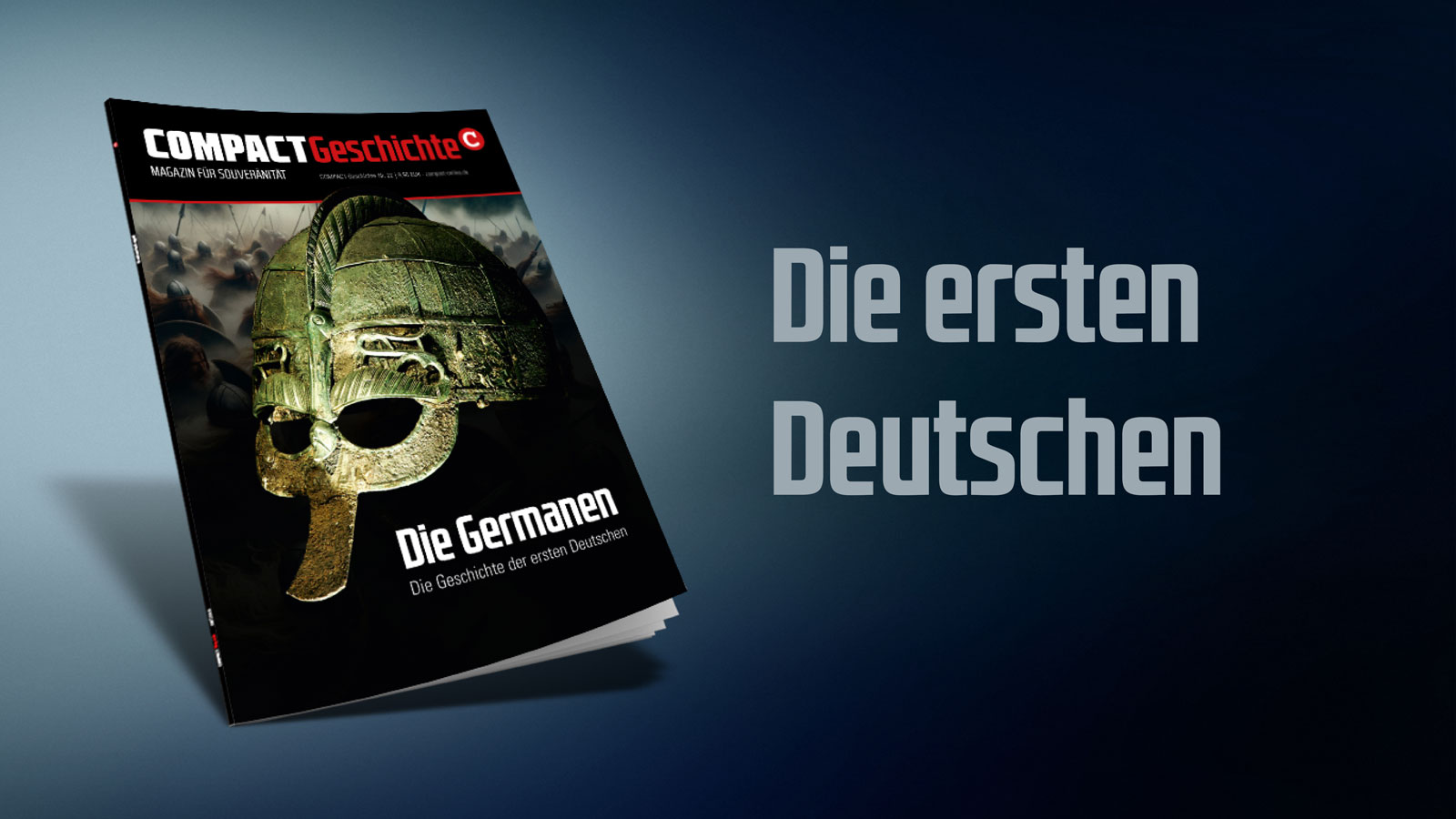
Das ist in diesem Fall gar keine, ich sag mal, typisch germanische Geschichte gewesen und da menschelt es sehr, und das ist auch der Grund dafür, dass es dann zu dieser Tragödie zwischen Marbod und Hermann gekommen ist. Es gab also keine wirtschaftlichen oder politischen Hintergründe im Großen und Ganzen, sondern das war wie immer: „Man kann nicht miteinander“ oder man findet nicht zueinander, das endet in einer tödlichen Feindschaft. Wie gesagt, das hätte ein wunderbares Drama auf der Bühne ergeben.
Den zweiten Teil dieses Interviews lesen Sie am 24. Dezember.
In unserer Sonderausgabe „Die Germanen – Die Geschichte der ersten Deutschen“ lesen Sie Wahrheit über den Freiheitskampf unserer Ahnen, ihre Kultur und ihre Bedeutung für die Herausbildung unserer Nation. Hier mehr erfahren.





