Wie verhielten sich die Germanen zu ihren Frauen – und wie die Germaninnen zu ihren Männern? Auch darüber hat Dr. Stephanie Elsässer mit dem Historiker Jan von Flocken gesprochen. In unserer Sonderausgabe „Die Germanen – Die Geschichte der ersten Deutschen“ lesen Sie Wahrheit über den Freiheitskampf unserer Ahnen, ihre Kultur und ihre Bedeutung für die Herausbildung unserer Nation. Hier mehr erfahren.
Den ersten Teil dieses Interviews lesen Sie hier.
Elsässer: Wenn wir schon bei den beiden Befreiungskämpfern sind: Haben nicht die Germanen schon vor den Griechen die Demokratie erfunden? Stichwort „Thing“.
Flocken: Eindeutig nein. Die griechischen Poleis mit ihrer Demokratie, das ist eine Erscheinung, die wir seit ungefähr dem 5. vorchristlichen Jahrhundert kennen. Da wissen wir nichts über die Germanen. Wir tauchen erst 300, 400 Jahre später schriftlich auf. Vielleicht hat es da einen „Thing“ gegeben, aber das können wir nicht nachweisen, also müssen wir in dem Fall doch ganz bescheiden sagen, dass wir den Griechen die Erfindung lassen, die Volksherrschaft und die Demokratie, weil die Germanen mit ihrem Thing zeitlich viel später kamen.
Interessanterweise allerdings, das unterscheidet jetzt mal die klassische Demokratie von dem Thing, ist, dass die Germanen ja Führer hatten, ein Wort, was heute ja völlig verpönt ist. Also Anführer, Fürsten hatten sie, die sich dann dem Thing-Spruch unterwerfen mussten, theoretisch, meistens auch praktisch, während in der Demokratie, da hat man die Fürsten erstmal weggejagt, die sogenannten Tyrannoi, und hat dann die Volksherrschaft ausgerufen. Bei den Germanen ging es etwas harmonischer zu, könnte man sagen, zwischen Herrschaft und Beherrschen.
Elsässer: Dann fand ich einen Ihrer Artikel sehr interessant, und zwar über Thusnelda, die Frau Hermanns. Thusnelda ist ja bis heute bekannt als Schimpfwort, als „Tussi“. Aber die Germanen hatten bestimmt noch mehr zu bieten. Was hat sie denn so gezeichnet, die Germanen?
Flocken: Ja, also kurz zu dem „Tussi“: Es ist interessant, ich konnte aber leider nicht herausfinden, wer das mal rausgebracht hat. Vielleicht irgendwelche armen, vom Lateinlehrer geplagten Schüler Ende des 19. Jahrhunderts, könnte sein. Was die germanischen Frauen angeht, da begebe ich mich sicherlich auf ein Terrain, wo einige sagen werden, der lebt ja noch 200 Jahre früher.
Treue, Keuschheit, Mut – das hat diese Frauen ausgezeichnet, diese Treue zum Ehemann, die Treue zur Sippe, ihre Keuschheit dahingehend, also Ehebruch, eines der schlimmsten Vergehen, was bei den Germanen immer mit dem Tode bestraft wurde, und ihr unglaublicher Mut, der sich sogar im Kampf gezeigt hat, Stichwort Kimbern und Teutonen. Und um das mal ganz grob auszuführen, was diesen unglaublichen Unterschied macht zwischen Germanen und den Mittelmeervölkern der Antike, da muss man sich mal auf das Gebiet der Mythologie begeben.
Die Mythologie ist ja das, was dem Volk einen Sinn gibt. Gucken wir uns die römisch-griechischen Götter an, die haben, Entschuldigung, wild durcheinander gevögelt. Göttervater Zeus oder Jupiter hatte eine Gemahlin, von der hatte er sogar zwei Kinder, und er hatte, soweit ich das richtig erinnere, 19 weitere Geschlechtspartnerinnen, mit denen er über 40 Kinder gezeugt hat. Also es gibt Zustände wie im alten Rom, sagt man dazu.
Nun schaut man sich den Göttervater Wotan oder Odin an, was hat der gemacht; der hat ein Auge geopfert dafür, dass er zwischen Gut und Böse unterscheiden kann und was ist das für ein riesenhafter Unterschied in der Mythologie, im Intellektuellen, im Gefühlsmäßigen zwischen diesem Wotan und diesem Jupiter, und das hat natürlich auch das Volk gefärbt und die germanischen Göttinnen von Frigga, Freia, Iduna, Ostara, das waren Idealgestalten und keine, die sich wie Venus oder Aphrodite oder die syrische Astarte sozusagen sich als Nutte in einem Bordell dargeboten haben.
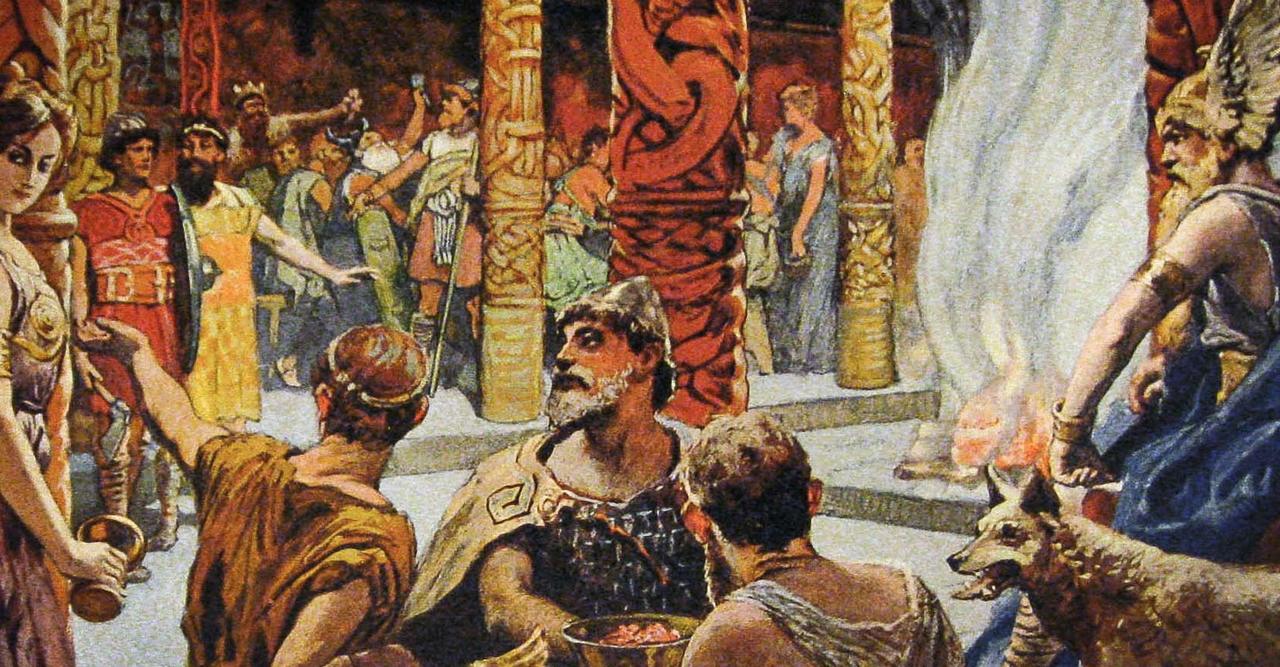
Das ist diese Sache, die auch Tacitus in seiner Germania so unheimlich erstaunt hat, dass diese germanischen Männer und Frauen so treu zueinander sind oder es mit einem Country Song zu sagen „Stand by your man whatever happens“. So war das bei den Germanen, und das hängt mit der Mythologie auch zusammen, und das ist dieser irrsinnige Unterschied zwischen den etablierten Mittelmeervölkern und den sogenannten Barbaren im Norden.
Elsässer: Ja, da möchte ich jetzt gerne zur Christianisierung kommen. Sie schreiben über den Bruderkrieg zwischen Franken und Sachsen, den Sieg des Franken Karl des Großen über die Sachsen, und ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass Sie diesen Sieg eher positiv werten. Aber bedeutete dieser Bruderkrieg zwischen Franken und Sachsen nicht auch das Ende des Germanentums?
Flocken: Also, es war mit Sicherheit der Untergang des heidnischen Germanentums. Karl dem Großen ging es darum, eine Reichseinheit zu schaffen, und das ging unter den damaligen Voraussetzungen nur mithilfe einer streng monotheistischen Religion. Diese kam aus Rom, damit hat er sich natürlich in eine fatale Abhängigkeit von Rom begeben. Aber ohne diesen gewaltsamen Sieg über die Sachsen wäre die Einheit der deutschen Stämme nicht zu erreichen gewesen, und das ist, so man das auch persönlich bedauern darf, den Untergang des alten Germanentums.
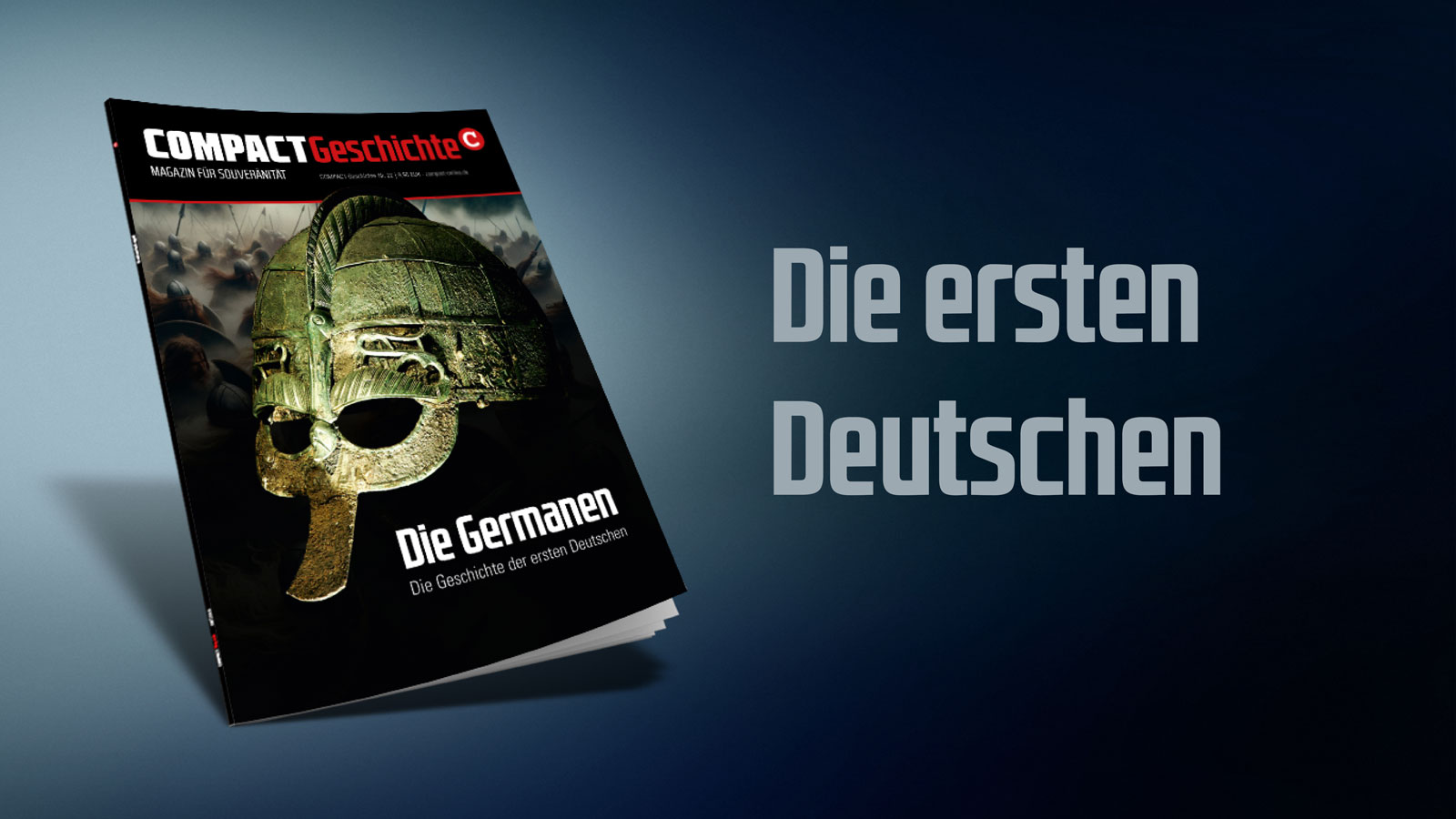
Aber das war das Fortschrittliche an dieser Geschichte. Ohne Karl den Großen und seine Einheitspolitik hätte es das Deutsche Reich, wenn überhaupt, dann erst Jahrhunderte später gegeben, und es hätte wieder Stamm gegen Stamm gekämpft. Das war ja nicht nur so, dass auf der einen Seite die Niedersachsen und auf der anderen Seite die Franken unter Karl waren, da waren ja auch die anderen Herzogtümer wie Lothringen, Bayern und so weiter. Diese waren schon geeint, und die Sachsen mussten mehr zu ihrem Glück gezwungen werden, oder sage ich mal, zur Einheit gezwungen werden. Darum scheint mir dieser Sieg von Karl dem Großen folgerichtig und auch sinnvoll für die deutsche Geschichte zu sein.
Den dritten und letzten Teil dieses Interviews lesen Sie am 26. Dezember.
In unserer Sonderausgabe „Die Germanen – Die Geschichte der ersten Deutschen“ lesen Sie Wahrheit über den Freiheitskampf unserer Ahnen, ihre Kultur und ihre Bedeutung für die Herausbildung unserer Nation. Hier bestellen.





