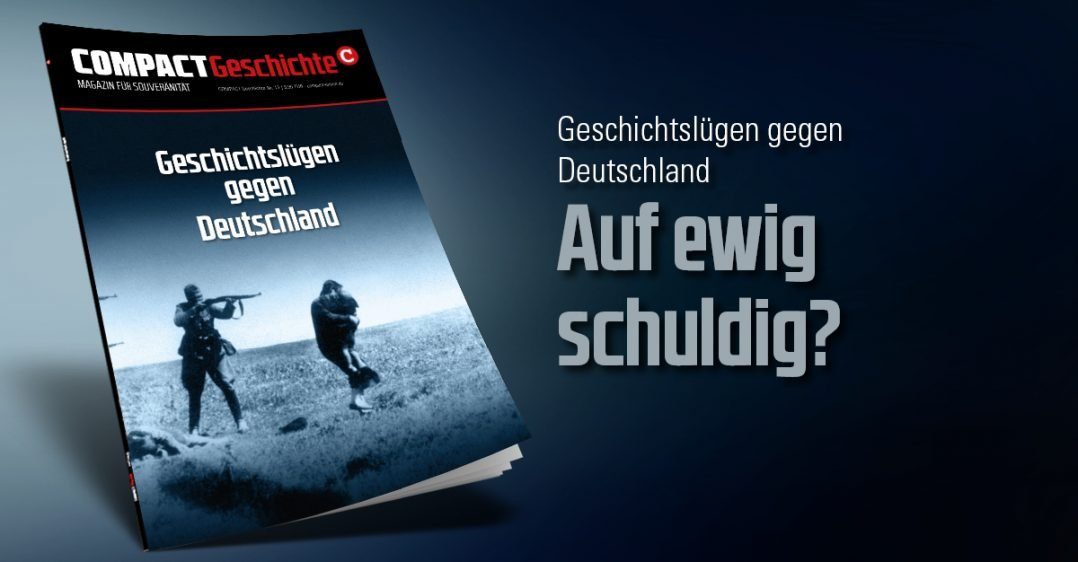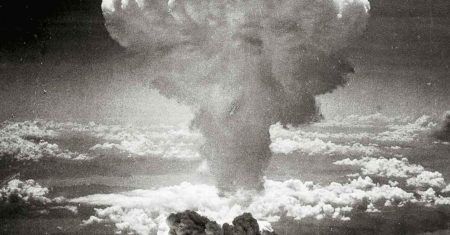Vor 125 Jahren zogen deutsche Soldaten nach China, um gemeinsam mit anderen Europäern den Boxeraufstand niederzuschlagen. Kaiser Wilhelm II. verabschiedete die Truppen am 27. Juli 1900 mit einer Rede, die bewusst verfälscht wurde. Dieser Artikel erschien zuerst in unserer Sonderausgabe «Geschichtslügen gegen Deutschland», über die Sie hier mehr erfahren.
Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs stellen nach dem Krieg eine besonders perfide Forderung an die sozialdemokratisch geführte Regierung des Deutschen Reiches. Unter Berufung auf den Artikel 226 des Versailler Vertrages vom Juni 1919 hieß es: «Die alliierten und assoziierten Mächte stellen Wilhelm II. von Hohenzollern, ehemaligen Deutschen Kaiser, unter öffentliche Anklage wegen schwerster Verletzung der internationalen Moral und der Heiligkeit der Verträge. Ein besonderer Gerichtshof wird gebildet werden, um den Angeklagten unter Wahrung der wesentlichen Punkte seines Verteidigungsrechtes zu richten.»
Außerdem verlangten die Sieger laut Artikel 228, die deutsche Regierung habe «alle Personen auszuliefern, die angeklagt sind, eine Handlung gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges begangen zu haben und die ihr namentlich oder nach dem Rang, dem Amt oder der Beschäftigung in deutschen Diensten bezeichnet werden». Zu diesen auszuliefernden Personen gehörten ranghohe Politiker wie der ehemalige Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg, militärische Führer wie Feldmarschall Paul von Hindenburg oder Großadmiral Alfred von Tirpitz bis hin zu Offizieren, U-Boot-Kommandanten und einfachen Soldaten. Die rachedurstige Liste umfasste 891 Personen, darunter General Hans von Schack, dessen Verbrechen angeblich darin bestand, «die Ausbreitung einer Typhusepidemie unter Kriegsgefangenen nicht verhindert zu haben und damit für den Tod Tausender verantwortlich zu sein».

Souveräne Persönlichkeit
Die Rolle des Hauptkriegsverbrechers aber sollte Kaiser Wilhelm II. zufallen, der sich seit November 1918 im holländischen Exil befand. Er diente einer alliierten Propaganda als bluttriefender Popanz, dessen Bestrebungen seit Jahrzehnten systematisch auf einen Weltkrieg zielten.
Das Gegenteil war der Fall. «Die Beweise von Friedfertigkeit und Achtung fremder Rechte, womit der Kaiser oft genug das Misstrauen und die Antipathien anderer Völker beantwortet hat, entspringen durchaus keiner Selbsttäuschung, keiner falschen Einschätzung ihrer Wirklichkeit, sondern einer ruhigen Selbstsicherheit», so 1913 die Einschätzung Wilhelm von Massows in Der Kaiser und die auswärtige Politik. Selbst der notorische Deutschenhasser Winston Churchill schrieb 1937 in seinem Werk Große Zeitgenossen : «Gemessen an den Versuchungen und unter Berücksichtigung der Umstände, ist die Lebensregel, welcher der Kaiser folgte, bemerkenswert. Er herrschte dreißig Jahre in Frieden.»
Programmatisch hatte Wilhelm II. das am 18. Juni 1897 bei einer Festveranstaltung in Köln formuliert: «So ist es mein Wunsch, dass Gott es mir verleihen möge, in den Bahnen meines Großvaters zu wandeln und der Welt den Frieden zu erhalten.»
Dennoch liebte Wilhelm II. öffentliche Auftritte und damit verbundene Reden nebst gelegentlich aggressiv anmutenden Metaphern. Seine Ansprachen hielt er fast immer ohne schriftliches Konzept. Freilich ließ er sich nie dazu hinreißen, seinen Soldaten Disziplinlosigkeiten zu befehlen. Als der Kaiser am 15. Juni 1894 in Potsdam die Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) verabschiedete, gab er ihr als Mahnung mit auf den Weg: «Haben Sie stets vor Augen, dass die Leute, die Sie dort treffen, wenn sie auch eine andere Hautfarbe haben, gleichfalls ein Herz besitzen, das ebenfalls Ehrgefühl aufweist. Behandeln Sie diese Leute mit Milde.»
Seine bis heute durch die Geschichtsbücher vagabundierende «Hunnenrede» vom 27. Juli 1900 vor Männern der nach Ostasien gehenden Bataillone, in der Wilhelm angeblich die Soldaten aufgefordert habe, in China wie die Hunnen zu hausen, ist eine Legende. Tatsächlich hatte der Monarch die Truppe aufgefordert: «Bewahrt die alte preußische Tüchtigkeit (…). Gebt an Manneszucht und Disziplin aller Welt ein Beispiel. (…) Führt eure Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus kein Chinese es wagt, einen Deutschen scheel anzusehen.»
Kluger Ratgeber
So war es im offiziellen Reichsanzeiger zu lesen. Hunnenkönig Etzel und seine Mongolenhorden tauchen nirgendwo auf. Warum auch? Wenn der Kaiser in seinen vielen Reden historische Vorbilder beschwor, dann waren es neben Preußen und dem Rittertum die Nibelungen und ihre unerschütterliche Treue. Ausgerechnet den tödlichen Gegner dieser Nibelungen, Hunnenkönig Etzel, seinen Soldaten als nachahmenswertes Beispiel zu empfehlen – das mutet sehr unwahrscheinlich an, zumal Wilhelm von irgendwelchen Hunnen weder zuvor noch danach jemals wieder gesprochen hat.
«Er herrschte 30 Jahre in Frieden.» Churchill über Wilhelm II.
Auch in letzter Minute, bevor der bosnische Konflikt sich zum Weltkrieg auswuchs, appellierte Wilhelm II. am Nachmittag des 31. Juli 1914 an den russischen Zaren: «In meinem Bestreben, der Welt den Frieden zu erhalten, bin ich bis an die äußerste Grenze des Möglichen gegangen. Die Verantwortung für das Unheil, das jetzt die ganze zivilisierte Welt bedroht, wird nicht auf mich fallen. Noch kann der Friede Europas durch Dich erhalten werden.» Diese Mahnung blieb vergeblich, ebenso Wilhelms dringende Bitte an den Zaren, «Europa nicht in den entsetzlichsten Krieg zu verwickeln, den es je gesehen hat». Noch in einer seiner letzten öffentlichen Reden, kurz nach dem Waffenstillstand mit der Ukraine, erklärte der Kaiser am 10. Februar 1918 in Bad Homburg: «Wir sollen der Welt den Frieden bringen, wir werden es tun auf jede Art.»
All dies passt schlecht zu der Rolle des finsteren Kriegstreibers, die dem Kaiser oft angedichtet wird. Es sind offenbar «kleinbürgerliche Vorurteile, mit denen moderne Historiker den letzten Deutschen Kaiser gouvernantenhaft benoten», so Joska Pintschovius in seinem Buch Der Bürgerkaiser (2008). Dadurch sei Wilhelm II. «bis in die aktuellste Zeit ein Opfer zeitgenössischer Projektionen und Diffamierungen» geworden.
Das alles passt nicht zur Rolle des Kriegstreibers.
Vielleicht sollten die aufgeregt Urteilenden beherzigen, was Wilhelm II. 1911 den Abiturienten des Gymnasiums in Kassel sagte: «Wenn Sie das politische Treiben zu verwirren droht, so rate ich Ihnen, für einige Zeit sich zurückzuziehen, sei es auf Reisen, sei es auf einem Spaziergang, und die Natur auf sich wirken zu lassen. Kehrt man dann zurück, so hat man einen freieren Blick über die realen Verhältnisse.» Die eingangs erwähnten 890 Männer wurden übrigens, ebenso wie der Kaiser, nicht an die Alliierten ausgeliefert. Das deutsche Volk und sämtliche Parteien einschließlich der Kommunisten weigerten sich, diesem Ansinnen nachzukommen. Man war damals der Meinung, dass ein verlorener Krieg zwar äußerst schmerzlich, aber noch lange kein Verbrechen sei.

Foto: Bundesarchiv, Bild 136-C0805, Oscar Tellgmann, CC-BY-SA, Wikimedia Commons
Stolz. Frei. Glücklich.
In der Tat kann man in Wilhelm II. einen typischen Preußen oder Deutschen sehen – nämlich einen ernst zu nehmenden Vertreter aus dem Land der Dichter und Denker. Sein Grundsatz, geäußert am 3. März 1904: «Hart sein im Schmerz, nicht wünschen, was unerreichbar oder wertlos ist, zufrieden mit dem Tag, wie er kommt. In allem das Gute suchen und Freude an der Natur und den Menschen haben, wie sie nun einmal sind; für tausend bittere Stunden sich mit einer einzigen trösten, welche schön ist, und an Herz und Können immer sein Bestes geben, wenn es auch keinen Dank erfährt. Wer das lernt und kann, der ist ein Glücklicher, Freier und Stolzer; immer schön wird sein Leben sein.»
Der Versuch, diesem Mann Persönlichkeitsstörungen anzudichten, die fatale Auswirkungen auf die Weltgeschichte gehabt hätten, muss misslingen. Denn: Er absolvierte als erster Preußenherrscher ein Universitätsstudium, sah blendend aus, die Frauenherzen flogen ihm zu. Trotzdem verliebte er sich nicht nur in die schüchterne, eher unscheinbare, noch dazu ein Jahr ältere und wenig begüterte Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein, er setzte die Heirat auch gegen alle Widerstände durch. Fast vier Jahrzehnte, bis zu ihrem Tod, wurde Auguste Viktoria eine unentbehrliche moralische Stütze an seiner Seite.
Die Begeisterung Wilhelms für moderne Naturwissenschaften war sprichwörtlich. Adolf Slaby, ein Pionier der Elektromechanik und der drahtlosen Telegrafie, erinnerte sich verblüfft, wie der Kaiser ohne Manuskript aus dem Stegreif einen anderthalbstündigen Vortrag über die Probleme des Schiffbaus hielt.
Bei all den psychologischen Erklärungsversuchen für das Handeln auch der bedeutendsten Entscheidungsträger darf eins nicht vergessen werden. Während von der Maas bis an die Memel, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine Spitzenleistung nach der anderen vollbracht und lautstark verkündet wurde, machte sich Deutschland natürlich europaweit nicht beliebter. Dass mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Folgen viele neidgeplagte Nationen einen unliebsamen, übermächtig scheinenden Konkurrenten lahmzulegen trachteten, ist eine naheliegende Sichtweise – und erheblich plausibler als vieles, das inzwischen als anerkannte Geschichtswissenschaft beansprucht wird.
Dieser Artikel erschien zuerst in unserer Sonderausgabe «Geschichtslügen gegen Deutschland». Wir rücken die schlimmsten Falschdarstellungen über unsere Historie gerade. Unverzichtbar, gerade in der heutigen Zeit. Hier bestellen.