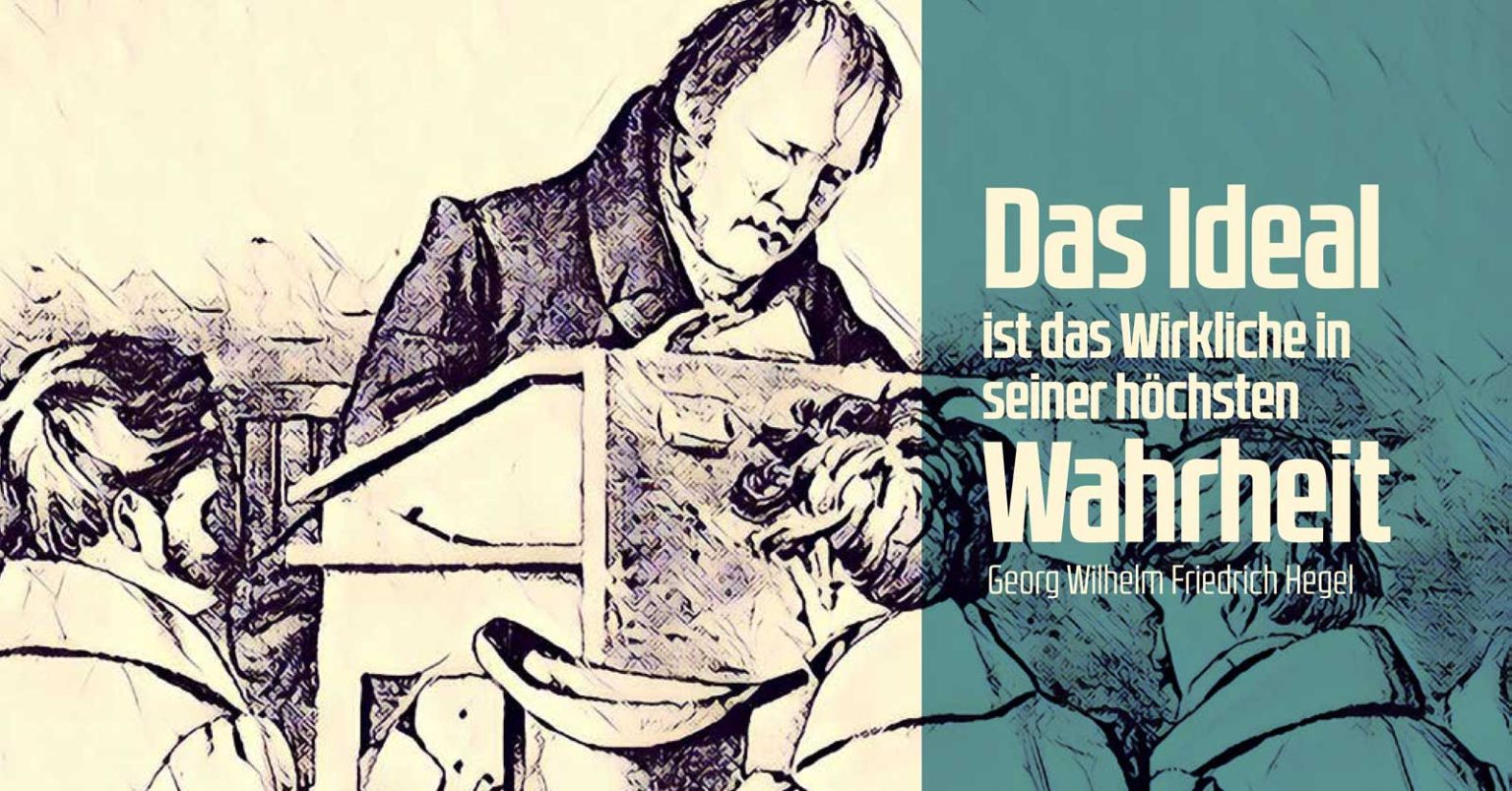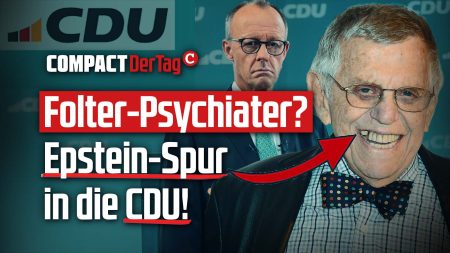Hat sich Hegels Geschichtsphilosophie blamiert? War seine Hoffnung auf stetigen Fortschritt des Menschheitsgeschlechts naiv? Kritische Fragen zum 255. Geburtstag des großen Philosophen. Halten Sie unbedingt zu COMPACT, gerade in diesen Zeiten. Sichern Sie sich unsere Druschba-Medaille in Silber. Hier mehr erfahren.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel war der wichtigste geistige Inspirator von Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin und damit sozusagen ein Geburtshelfer des Sozialismus, aber er wird trotzdem das Image eines konservativen Staatsvergotters nicht los.
Hegel, das ist der früh gealterte Musterschüler, der zerstreute Professor, der beim Spaziergang am Berliner Kupfergraben seinen Schuh verlor – ohne es zu bemerken. Obrigkeitstreu und weltfremd. Dabei zeigen alle Dokumente das Gegenteil.
Als Tübinger Student begeisterte er sich für die Französische Revolution – bis zu seinem Tod 1830 feierte er ihren Jahrestag mit Schampus. Stets zählte er Aufständische und radikale Literaten zum engsten Freundeskreis. Er übersetzte und publizierte Schriften der Girondisten, pflegte Kontakt zu den Anführern der jakobinischen Mainzer Republik und vermittelte Revoluzzer-Briefe nach Paris. Das war Hochverrat hoch zehn!

In Bamberg forderte er als politischer Journalist napoleonische Gesetzgebung. Jahrzehnte später noch, als er Philosophieprofessor in Berlin war, verdächtigte ihn der königliche Hof des Republikanismus und ließ ihn beschnüffeln. Diese kleine Auswahl belegt hinreichend, dass Hegel weder weltfremd noch unterwürfig, sondern – wie sein aktueller Biograf Klaus Vieweg in seinem gleichnamigen Buch feststellt – „der Philosoph der Freiheit“ war.
Fortschritt ohne Rückschritt
Die gesamte Menschheitsgeschichte galt Hegel als zielgerichteter Prozess, an dessen Ende notwendig die Freiheit des Einzelnen stehen werde. Dieses Reich, so eine spätere Deutung, wäre zugleich „das Ende der Geschichte“ (Alexander Kojève).
Im frühen 20. Jahrhundert erschien eine solche Zukunft unmöglich. So erklärte der Staatsrechtler Carl Schmitt, Hegel sei am 30. Januar 1933, mit der Machtergreifung Adolf Hitlers, „gestorben“.
Erst in den 1990ern, nach dem Zusammenbruch des osteuropäischen Sozialismus, glaubte wieder ein Philosoph, Francis Fukuyama, an Das Ende der Geschichte (1992). In seinem gleichnamigen Bestseller fantasierte der Autor vom globalen Endsieg der liberalen Demokratie. Später musste Fukuyama erkennen, dass der historische Prozess keineswegs seinen Schlusspunkt erreicht hat. Im Gegenteil: Der entfesselte Globalismus brachte nicht den Triumph, sondern den Verfall des Liberalismus und der westlichen Staaten.
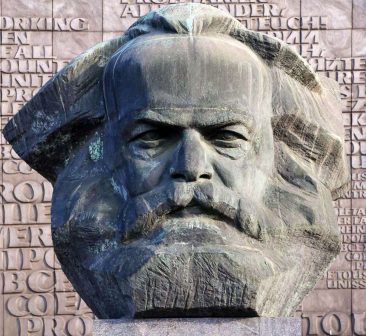
Foto: MarclSchauer / Shutterstock.com
Das ist keineswegs eine historische Premiere: Alle Kulturen, Staaten, Reiche sind aufgestiegen, haben geblüht und verschwanden schließlich. Das scheint so unvermeidlich, dass Oswald Spengler (Der Untergang des Abendlandes ) diesen ewigen Zyklus mit der Pflanzenmorphologie beschrieb. So verlockend einleuchtend dieser Vergleich sein mag, so wenig erklärt er das „Warum“.
Moralinsaure Historiker ziehen an dieser Stelle gern die Dekadenz-Theorie aus dem Hut, mit dem spätantiken Rom als favorisiertem Beispiel. Erklärt wird damit nichts: Der Niedergang einer Zivilisation wird mit dem Niedergang von deren Kultur erklärt – eine Tautologie. Aber aus welchem Grund können (oder wollen) Menschen ihr einmal erreichtes Niveau nicht länger halten? Weshalb scheiterten immer wieder Versuche einer Wiederbelebung von Traditionen?
Lob des Widerspruchs
Bevor wir Hegel zu dieser Frage konsultieren, ist eine Skizze seiner Geschichtsphilosophie vonnöten. Von entscheidender Prägung für den jungen Philosophen war die zeitgenössische Aufklärung. In deren Zentrum stand die sogenannte Vernunft, das rationale Denken. Durch dessen Gebrauch könne der Mensch seine Mündigkeit erlangen, seine Autonomie gegen alle politischen und religiösen Autoritäten verteidigen. Aber wo findet sie sich?
Für Immanuel Kant war die Vernunft nur geistig erkennbar. Das war Hegel zu wenig. Die Vernunft müsse auch in der sinnlichen, äußerlichen Welt anzutreffen sein. Der Denker suchte und fand sie in der Geschichte: Deren Wirklichkeit ist vernünftig, so lautet seine pointierte Formulierung. Moment! Die völlig irre Abfolge unzähliger Kriege, politischer Willkür, von blutigen Aufständen und ihrer Niederschlagung – das soll „vernünftig“ sein?
Nun wusste Hegel selber, dass die Geschichte eine „Schlachtbank“ ist. Aber gerade die furchtbaren historischen Einbrüche bedeuten für ihn keinen Rückschritt für die Menschheit, sondern sind Grundbedingungen des Fortschritts: Erst die Dynamik von Kriegen und Revolutionen treibt ihn voran. Der Geschichtsprozess verläuft auch in den Epochen entfesselter (scheinbar sinnloser) Gewalt nicht sinnlos, denn hinter ihm steckt der „Weltgeist“.
Dieser entwickelt sich nicht durch das beständige Erstarken des Guten, sondern gerade durch seine ständige Infragestellung durch das Böse. Im Kampf von These und Antithese siegt keine von beiden, sondern etwas Drittes, Neues: die Synthese. Das ist das Kernelement der Hegelschen Dialektik.
Von Marx wurde diese Denkweise so übersetzt: Indem der Kapitalismus die Bauernschaft und den Mittelstand vernichtet und alle vorher Selbständigen unter schlimmsten Bedingungen in die Fabriken presst, bringt er seinen eigenen Totengräber hervor, das Proletariat.
Nicht im Zurück, sondern im Vorwärts…
Nicht die Kräfte des Alten besiegen die neuen Ausbeuter – sondern die Geschöpfe, die das Neue beziehungsweise dessen innerer Widerspruch überhaupt erst hervorgebracht hat. Nicht im Zurück, sondern im Vorwärts liegt die Hoffnung – deshalb gab die SPD 1876 auch ihrem Zentralorgan genau diesen Namen.
Menschliche Individuen sind in Hegels Evolutionsprozess nur Komparsen, deren Kämpfe nur Mittel zum metaphysischen Zweck. Napoleon beispielsweise galt ihm als „Weltseele“ (von Nachgeborenen in „Weltgeist zu Pferde“ vergröbert).
Tatsächlich: Obwohl der Korse als Kaiser und Imperator andere Länder unterwarf, sorgte er für die Verbreitung der Freiheitsideen der französischen Revolution in den besetzten Ländern. Dass die Preußen Bonaparte schließlich besiegen und aus Deutschland jagen konnten, hing nicht zuletzt damit zusammen, dass sie vom republikanischen Geist angesteckt worden waren.
Das Resultat der immer wiederkehrenden Kämpfe ist für Hegel die völlige Selbsterkenntnis: „Die Weltgeschichte zeigt nur, wie der Geist allmählich zum Bewusstsein und zum Wollen der Wahrheit kommt; es dämmert in ihm, er findet Hauptpunkte, am Ende gelangt er zum vollen Bewusstsein.“ Für den Menschen bedeutet dieser Prozess ein ständiges Voranschreiten zu Vernunft und Freiheit.
Aufgehoben, nicht untergegangen
In seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie verwendet Hegel eine Schlangensymbolik: Der Weltgeist häutet sich regelmäßig und wird mit jeder Häutung reiner. Die vergehende, überholte Kulturepoche ist eine abgestreifte, zurückgelassene Schlangenhaut. Die lebt nicht mehr, muss vertrocknen. Dieser Moment der Häutung ist gekommen, wenn „der Bestand eines Volksgeistes, wie er ist, durchbrochen wird, weil er sich ausgeschöpft und ausgearbeitet hat, dass die Weltgeschichte, der Weltgeist fortgeht“.
Jedes Volk hat demnach irgendwann sein Potenzial ausgeschöpft. Dann ist seine Mission erfüllt, es wird vom Weltgeist verlassen. Ihm droht, in Hegels Worten, „Herabsetzung, Zertrümmerung, Zerstörung der vorhergehenden Weise der Wirklichkeit“. Er spricht von der „Geistlosigkeit“ der absterbenden Kultur, was aber nicht im Sinne mangelnder Intelligenz zu verstehen ist: Vielmehr regt sie die Geister nicht mehr an, entfacht keine Begeisterung mehr, ist nicht mehr dynamisch. Alle ihre Stützen bekommen Risse, brechen ein.
Hegels Erzählung vom Niedergang ähnelt von Ferne dem metaphorischen Verblühen, mit dem Spengler das Endstadium einer Kultur beschreibt. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied: Bei Hegel sind die wichtigsten Ideen untergegangener Epochen nicht verschwunden, sondern „aufgehoben“. Sie wirken weiter und beeinflussen die neue Zeit. Tatsächlich: Wie viele Impulse, Vorstellungen und Denkmodelle der Gegenwart lassen sich zurückführen auf die griechische, römische oder hebräische Antike.
Hegel, ganz Kind der Aufklärung, hat die westliche Vernunftsidee ins Zentrum seiner Geschichtsbetrachtung gestellt. Kulturen, in denen er diese Vernunft nicht vorfand, galten ihm als weiße Flecken auf der weltgeistigen Landkarte. Ihnen sprach er jeden Beitrag zur geschichtlichen Entwicklung ab.

Womöglich aber ist der Weltgeist geografisch flexibel? Vielleicht erklimmt er seine nächste Entwicklungsstufe in einem Erdteil, der zu Hegels Zeit noch als marginal galt. Diese Erfahrung machte der Schriftsteller Ernst Jünger. Durch den Philosophen Hugo Fischer in Hegels Denken eingeübt, glaubte der Autor der Stahlgewitter im Jahre 1926, Deutschland habe das Recht, sich als „Sprachrohr des Weltgeistes“ zu bezeichnen.
„Eine Residenz des Weltgeistes“
Zehn Jahre später unternahm er eine Schiffsreise nach Brasilien. Nach wochenlanger Fahrt, ausführlicher Beobachtung von Flora und Fauna und einer Zwischenstation in Sao Paulo fährt er in den Hafen von Rio de Janeiro ein. Die Stadt erschlägt ihn fast. Intuitiv erfasst Jünger ihre Bedeutung für die globale Zukunft: „Eine Residenz des Weltgeistes“, schrieb er am 20. November 1936 in sein Tagebuch.
Konnten die Römer parallel zum Verschwinden ihrer Götter das Aufkommen des Christentums konstatieren, steht heute die abendländisch-christliche Kultur selbst zur Disposition. Liegt ihre Nachfolge vielleicht in der Überwindung des biologischen Menschseins? Zahllose Informatiker in Silicon Valley sind davon überzeugt, dass sich Seele und Verstand auf digitaler Basis kopieren und in ihrer angeblichen Leistungsfähigkeit gar steigern ließen. Der Übermensch aus Bio-Chips…
Ist der Glaube, dass sich Geist auf materialistischer Basis erklären und im Computer konstruieren lasse, nicht ein Überbleibsel der gottlosen Epoche, die 1789 ihren Siegeszug begonnen hat und jetzt stirbt? Geht dieses Überbleibsel also mit jener Kultur der Aufklärung unter, oder kann sie, hegelianisch „aufgehoben“, Element eines neuen post-humanistischen Zeitalters werden? Und wäre im letzteren Fall nicht der Weltgeist gemordet und Hegels Fortschrittsglaube auf noch schrecklichere Weise als Fukuyamas Illusionismus widerlegt?
Heute, am 27. August, jährt sich der Geburtstag Hegels zum 255. Male. Wir erinnern an ihn. Halten Sie unbedingt zu COMPACT, gerade in diesen Zeiten. Sichern Sie sich unsere Druschba-Medaille in Silber. Hier mehr erfahren.