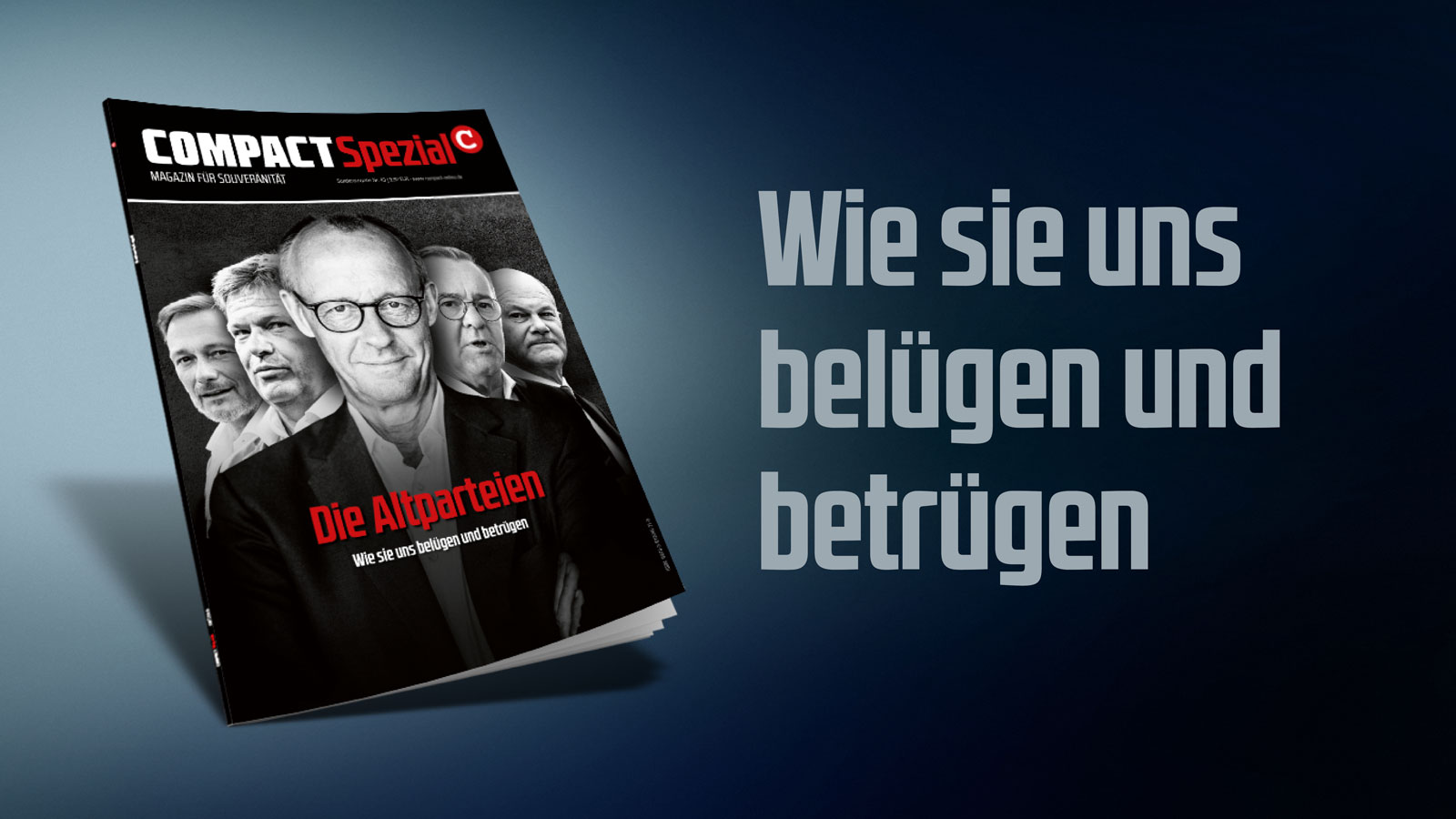Das heutige Dreikönigstreffen der FDP kommt für Parteichef Lindner denkbar ungelegen. Die Stimmung bei den Liberalen ist am Tiefpunkt. Zu Recht! Die FDP ist nur ein Schatten vergangener großer Tage. Das arbeitet COMPACT-Spezial „Die Altparteien. Wie sie uns belügen und betrügen“ heraus. Hier mehr erfahren.
Das traditionelle Dreikönigstreffen am heutigen Tag in Stuttgart hätte der FDP kurz vor der Bundestagswahl Auftrieb geben können. Stattdessen aber geht es um Schuldzuweisungen und innerparteiliche Abrechnungen. Meinungsforschungsinstitute sehen die Freien Demokraten derzeit einheitlich unter fünf Prozent und damit bald schon nicht mehr im Bundestag vertreten.
Die Neue Zürcher Zeitung: „Die Stimmung sei ‚ziemlich am Boden‘, viele Mitglieder an der Basis seien ‚resigniert‘, berichtet ein gut vernetztes Parteimitglied. Gerade in ländlichen ostdeutschen Regionen fehle mittlerweile die Kraft für einen engagierten Wahlkampf.“ Keine Frage: Es droht die Bedeutungslosigkeit.
Toilette statt Lindner
Mit seiner ellenlangen Rede am heutigen Mittag hat Lindner das Ruder jedenfalls nicht herumreißen können. Zwar gab es keine Pfiffe, sondern höflichen Beifall für den angeschlagenen Parteivorsitzenden, aber Begeisterung sieht nun wirklich anders aus. Die Bild vermeldete in ihrem Liveticker: „Lindner redet jetzt schon gut 40 Minuten. Bislang war wenig Überraschendes dabei. Und auch im Saal scheint sich ein wenig Trägheit einzustellen trotz lautem Applaus zwischendurch. Saßen die Parteimitglieder lange Zeit still auf ihren Plätzen, wird es aktuell etwas unruhiger, hier und da verlassen Zuhörer den Saal, nutzen die Zeit, um auf Toilette zu gehen.“
Im Grunde ist es sehr bitter, was aus der FDP geworden ist. Denn die Partei hat die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte durchaus mitgeprägt. Einer derjenigen, die sich nach dem Krieg leidenschaftlich für Aussöhnung und gegen einseitige Schuldzuweisungen einsetzten, war Thomas Dehler, von 1949 bis 1953 Bundesminister der Justiz und von 1954 bis 1957 Parteivorsitzender der FDP. Sein Schlussstrich-Plädoyer war umso bemerkenswerter, da er im Dritten Reich drangsaliert worden war, weil er eine Jüdin geheiratet hatte. Und doch setzte er in seiner Eigenschaft als Bundesjustizminister ein Amnestiegesetz durch, um das politische Leben in der Bundesrepublik „zu entgiften“, wie er sagte.
Dehler, der aus Oberfranken stammte, war liberal – also freiheitlich – im besten Sinne und Patriot durch und durch. Unablässig suchte er nach Wegen zur Wiedervereinigung und war bekannt für seine Appelle zur Rückgewinnung des von den Franzosen annektierten Saargebiets – was 1957 gelang.
Heuss als Leuchtturm
Die herausragende Persönlichkeit der FDP damals war zweifelsohne Theodor Heuss. Der erste Bundespräsident (1949–1959) begeisterte sich schon in jungen Jahren für die Ideen des liberalen Vordenkers Friedrich Naumann und wirkte in dessen Nationalsozialem Verein mit. Als Reichstagsabgeordneter der DDP stimmte Heuss 1933 zwar dem Nazi-Ermächtigungsgesetz zu, doch erst ein Jahr zuvor hatte er mit seinem Buch Hitlers Weg den Nationalsozialismus historisch, politisch und soziologisch kritisiert. Die neuen Machthaber verbrannten die Schrift öffentlich. 1948 wurde Heuss auf dem Gründungsparteitag der FDP zu deren erstem Vorsitzenden gewählt.
Es gab nach dem Krieg einen starken nationalliberalen Flügel, der sich vor allem in Nordrhein-Westfalen um den dortigen Landeschef Friedrich Middelhauve gruppierte. Im Juli 1951 verabschiedete der Verband ein Programm, das sich klar für die Soziale Marktwirtschaft aussprach, ein Jahr später wurde auf einem Parteitag in Bielefeld der „Aufruf zur Nationalen Sammlung – Deutsches Programm“ beschlossen.
Darin bekannten sich die NRW-Liberalen „zum Deutschen Reich als der überlieferten Lebensform unseres Volkes und der Verwirklichung seiner Einheit“. Man erklärte: „Deutschland kann und wird nie auf das Recht der Rückkehr der Vertriebenen in ihre Heimat verzichten.“
„Für Fortschritt durch Vernunft“
Freilich gab es von Anfang an eine Gegenbewegung zur markt- und nationalliberalen Strömung. Den Höhepunkt des Wirkens dieses linken Flügels markierte 1971 – also zur Zeit der sozialliberalen Koalition unter SPD-Kanzler Willy Brandt – die Verabschiedung der „Freiburger Thesen“ als neues Grundsatzprogramm der FDP.
Maßgeblicher Verfasser war Karl-Hermann Flach, unterstützt wurde das Papier vom damaligen Parteivorsitzenden und späteren Bundespräsidenten Walter Scheel. „Liberalismus“, hieß es in dem Papier, „nimmt Partei für Menschenwürde durch Selbstbestimmung“ sowie „für Fortschritt durch Vernunft“. Und er „fordert Demokratisierung der Gesellschaft“ sowie eine „Reform des Kapitalismus“.
Neben Scheel war Außenminister Hans-Dietrich Genscher zu dieser Zeit die prägende Persönlichkeit in der FDP. Später spielte auch Otto Graf Lambsdorff eine bedeutende Rolle – insbesondere 1982, als die Liberalen die Koalition mit der SPD unter Kanzler Helmut Schmidt aufkündigten und, CDU-Chef Helmut Kohl an die Macht brachten. Einmal mehr spielte die FDP den Mehrheitsbeschaffer.
Mit Mende nach vorn
Den Ruf als „Umfallerpartei“ erwarb sie sich allerdings schon 1961. Als Gegner Konrad Adenauers hatte der damalige FDP-Chef Erich Mende zunächst eine Koalition mit CDU und CSU abgelehnt. Als die Union dann aber auf Adenauers Kanzlerschaft bestand, gaben die Liberalen nach; Mende trat zunächst nicht in das Kabinett ein. Erst nach dem versprochenen Rücktritt des Alten von Rhöndorf 1963 wurde er Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und zugleich Vizekanzler unter dem neuen CDU-Kanzler Ludwig Erhard.
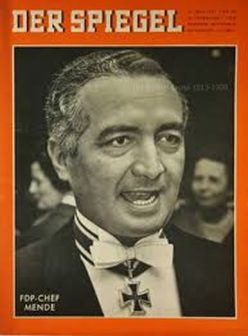
Mende, der aus Oberschlesien stammte und als Offizier der Wehrmacht mehrfach ausgezeichnet worden war, kann als letzter großer Nationalliberaler der FDP bezeichnet werden. Nach dem Krieg trug er – übrigens auf Anregung von Theodor Heuss – bei öffentlichen Anlässen sein Ritterkreuz, das ihm im Februar 1945 verliehen worden war. Unter seiner Führung erreichten die Freien Demokraten bei der Bundestagswahl 1961 mit 12,8 Prozent das bis dahin beste Ergebnis.
Enttäuscht über die Rolle der Liberalen in der Regierung Brandt und in scharfer Gegnerschaft zu dessen neuer Ostpolitik, verließ Mende im Oktober 1970 die FDP in Richtung CDU, für die er 1972 und 1976 erneut in den Bundestag gewählt wurde.
Nach Genschers Abtritt fehlte der Partei eine Persönlichkeit von dessen Format. Die vom späteren Generalsekretär und Partei-Primus Guido Westerwelle nach der Jahrtausendwende erträumten 18 Prozent auf Bundesebene waren nie ernsthaft in Reichweite. Die 7,4 Prozent bei der Bundestagswahl 2002 sorgten trotz Westerwelle-Hype für Katerstimmung.
Verantwortlich für das Debakel wurde Ex-Minister Jürgen Möllemann gemacht, der kurz vor dem Urnengang entmachtet worden war, nachdem er zuvor versucht hatte, die Freien Demokraten zu einer Volkspartei neuen Typs umzugestalten. Seine Kritiker warfen ihm eine Haiderisierung der FDP vor – ein Verweis auf den österreichischen Politiker Jörg Haider, der die frühere Schwesterpartei FPÖ auf rechten Kurs geführt hatte. Dieser kam 2008, ähnlich wie Möllemann 2003, unter mysteriösen Umständen ums Leben. Dass der Münsteraner sogar am Schuldkult gerüttelt hatte, wurde ihm nie verziehen.
Von Westerwelle zu Lindner
Bei der Bundestagswahl 2009 konnte die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Westerwelle den Rekord aus der Mende-Ära brechen. Mit 14,6 Prozent zog man in den Berliner Reichstag ein und diente sich Merkel als Koalitionspartner an. Bereits im Juni 2010 sagten Umfragen der Partei nur noch knapp fünf Prozent voraus, durch ihre Komplizenschaft bei der Eurorettungspolitik sank das Vertrauen innerhalb der Anhängerschaft weiter, sodass die Liberalen bei der Bundestagswahl 2013 nur noch 4,6 Prozent erreichten und damit erstmals seit ihrer Gründung nicht mehr im Hohen Haus vertreten waren. Der Parteivorstand trat komplett zurück – und machte den Weg für Christian Lindner frei…
Die Rolle der FDP in der Bundesrepublik wird erstklassig beleuchtet im COMPACT-Spezial „Die Altparteien – Wie sie uns belügen und betrügen“. Hier bestellen.