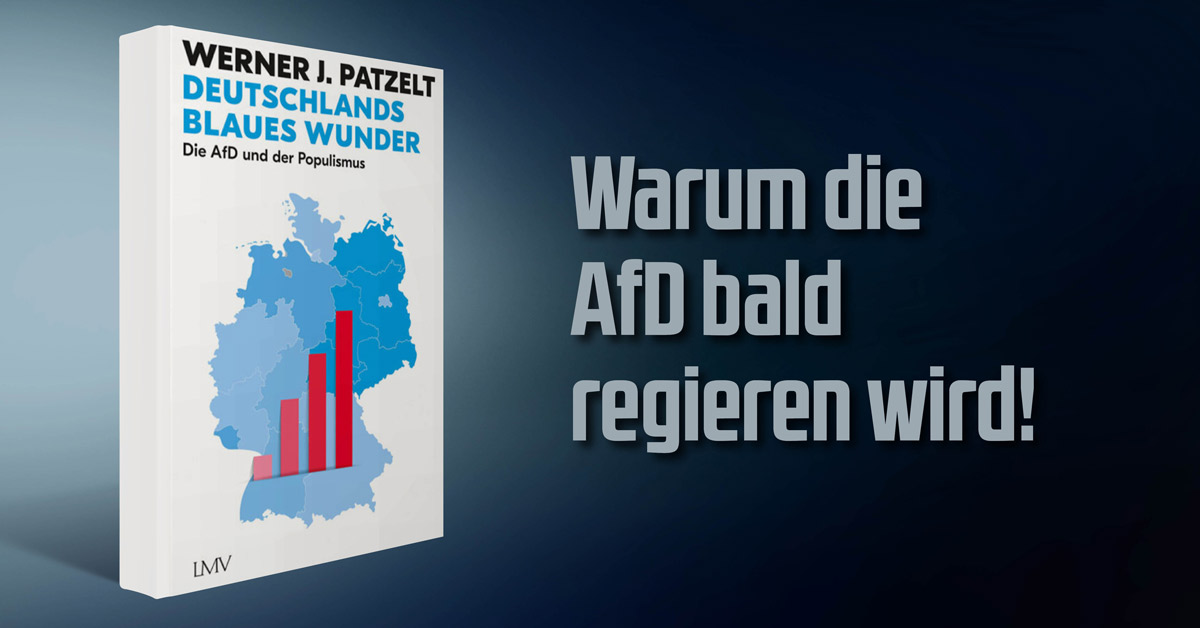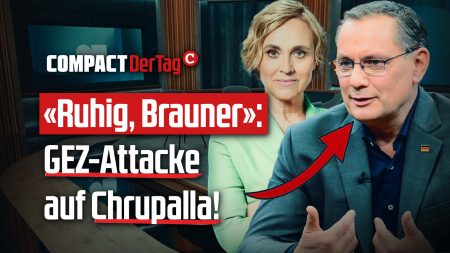In den bundesweiten Umfragen liegt die AfD teilweise schon vor CDU/CSU, in den Ost-Ländern ist sie bereits stärkste Kraft. Wie die Partei zum relevanten politischen Faktor wurde – und warum sie weiter aufsteigen wird, erklärt Polit-Experte Werner Patzelt in seinem aktuellen Werk „Deutschlands blaues Wunder“. Analytisch, kritisch, faktenbasiert! Hier mehr erfahren.
Die AfD hat das erreicht, was keine andere Partei seit den Grünen geschafft hat: Sie hat sich erfolgreich im Parteienspektrum der Bundesrepublik etabliert, ist in allen Landtagen, im Bundestag und im Europaparlament vertreten – und das schon seit mehreren Legislaturperioden.
Doch das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht: Die Umfragewerte der Blauen steigen von Woche zu Woche, und schon im kommenden Jahr könnte es den ersten Ministerpräsidenten der AfD in Sachsen-Anhalt geben.
„Empörungsbewegung“ gegen das Establishment
Viele fragen sich: Wie konnte es zu dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte kommen? Warum ist die AfD so stark – und wie stark wird sie noch werden. Diese und viele weitere Fragen rund um die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla beantwortet der renommierte Politikwissenschaftler Werner Patzelt in seinem aktuellen Buch „Deutschlands blaues Wunder“ – eine Studie von 320 Seiten, die ebenso fundiert wie unbequem ist. Analytisch, kritisch, faktenbasiert – und vor allem: ohne Schaum vor dem Mund.
Patzelt betrachtet die AfD dabei nicht als isoliertes Phänomen, sondern als Symptom einer tiefer liegenden politischen und gesellschaftlichen Krise. Sein Befund: Die Stärke der AfD ist das Ergebnis einer Politik, die zu lange bestimmte Themen ignoriert oder tabuisiert hat – und damit große Teile der Bevölkerung entfremdete.

In „Deutschlands blaues Wunder“ analysiert der bekannte Polit-Erklärer die AfD sine ira et studio – wissenschaftlich neutral und sachlich. Für Patzelt ist die Partei eine „Empörungsbewegung“, die sich nicht ins alte Parteiensystem einfügen will und aus Sicht ihrer Wähler eine „Alternative zu vaterlandsschädigender Politik“ darstellt, wie es der Verlag des Autors formuliert.
Der emeritierte Dresdner Politikprofessor analysiert, was die AfD so stark gemacht hat: Die Krise nach der sogenannten Energiewende, die zur Desindustrialisierung führt; die Migrationspolitik seit Merkel (laut Patzelt die „Ur-Mutter der AfD“) mit all ihren gesellschaftszerstörenden und sicherheitsgefährdenden Folgen; die Gleichstellungsgesetze als Zwang einer Transformation, die die Mehrheit ablehnt.
All dies sei „nahrhaftes Futter für jede Opposition, und das ist zum gegebenen Zeitpunkt die AfD“, so ein Rezensent auf Tichys Einblick, der feststellt: „Die Energiekrise nach der Energiewende wuchert sich zur Desindustrialisierungskrise aus. Die Migrationskrise hat buchstäblich gesellschaftsverändernde, möglicherweise gesellschaftszerstörende Folgen.“
Vom „Pegida-Versteher“ zum AfD-Erklärer
Autor Patzelt ist politisch ein Konservativer, doch vor allem gilt er als einer der profiliertesten Politikwissenschaftler Deutschlands und war als Experte Gast in vielen Wahlsendungen, bis seine Ansichten dem Medien-Establishment zu unbequem wurden.
Bekannt wurde er unter anderem durch seine Pegida-Studien an der TU Dresden. Als die zuwanderungskritische Protestbewegung 2014 aufkam, war er einer der wenigen, die nicht sofort mit moralischer Empörung reagierten, sondern wissenschaftlich untersuchten, wer dort demonstriert, warum und aus welchen Motiven.
Patzelt fand heraus, dass ein erheblicher Teil der Pegida-Anhänger bürgerlich geprägt war: Menschen mit geregeltem Beruf, Familien, teilweise akademischem Hintergrund, die sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlten. Sie sahen sich nicht als Extremisten, sondern als Bürger, die Gehör finden wollten.

Weil Patzelt mit diesen Befunden an die Öffentlichkeit ging, statt die Bürgerbewegung pauschal zu verurteilen, wurde er in Medien und Politik bald als „Pegida-Versteher“ etikettiert – ein Begriff, der mehr über die damalige Diskussionskultur aussagt als über die Forschung des Professors.
Man warf Patzelt damals vor, zu nah dran zu sein, Ressentiments zu bedienen oder sogar Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben – weil er es wagte, die „besorgten Bürger“ nicht einfach als Nazis abzustempeln. Stattdessen forderte er die Politik auf, auf das „Gegrummel im Volk“ einzugehen, statt es wegzudrücken.
Seine Studien, die in dem Werk „Pegida: Warnsignale aus Dresden“ (Thelem, 2016) mündeten, zeigten: Diese Menschen wollen keine Diktatur, sie wollen gehört werden. Und wer das ignoriert, schürt nur mehr Frust. Patzelt wurde wegen seiner Pegida-Studien angegriffen – Studenten verteilten Flugblätter gegen ihn, Kollegen distanzierten sich –, aber er blieb standhaft.
Stich ins Wespennest
Mit „Deutschlands blaues Wunder“ sticht der streitbare Politologe nun erneut in ein Wespennest. Denn ein ungeschriebenes Gesetz der bundesdeutschen Publizistik lautet: Wenn du über die AfD schreibst, dann bitte nur abwertend und verdammend. Genau das macht Patzelt jedoch nicht – er nähert sich dem Phänomen mit dem neutralen Blick eines Wissenschaftlers und fördert so bemerkenswerte Erkenntnisse zutage.
Hierbei greift er in gewisser Weise auf seine früheren Pegida-Studien zurück: Die Themen, die bei durch die damaligen Demonstrationen in Dresden an die Oberfläche kamen – Migration, Identität, politische Repräsentation, Vertrauensverlust – seien von den etablierten Parteien, so Patzelt, nicht aufgenommen, sondern verdrängt worden.

Genau in diesem politischen Vakuum konnte sich die AfD entfalten. Aus der eurokritischen Professorenpartei der Anfangsjahre wurde eine Sammlungsbewegung enttäuschter Konservativer, Nationalgesinnter und politischer Querdenker. Nicht weil sie alle dieselben Ziele teilten, sondern weil sie sich gemeinsam von der politischen Klasse missverstanden fühlten.
Patzelt sieht darin keine „Verirrung der Demokratie“, sondern eine Reaktion auf ihre Einseitigkeit. In „Deutschlands blaues Wunder“ schreibt er:
„Wenn sich ein wachsender Teil der Wähler im Parteienspektrum nicht mehr repräsentiert findet, dann entsteht zwangsläufig eine neue Partei – oder eine Demokratiekrise.“
Die AfD sei insofern Produkt einer strukturellen Verschiebung: Während sich CDU/CSU, SPD und Grüne programmatisch immer stärker auf eine Mitte-Links-Politik ausgerichtet hätten, blieb rechts von der Union eine repräsentative Lücke, die die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla zu füllen wusste.
Krise der repräsentativen Demokratie
Patzelt beschreibt in seinem neuen Buch den Aufstieg der AfD als „blaues Wunder der deutschen Politik“, weil sie als unerwünschte, ja bekämpfte Kraft dennoch wächst. Er analysiert Wahlverläufe, Mitgliederstrukturen, programmatische Entwicklungen – aber auch die kommunikative Ausgrenzung, die aus seiner Sicht demokratiegefährdend wirkt.
Sein zentrales Argument:
„Eine Demokratie, die relevante Teile ihrer Bevölkerung dauerhaft aus dem öffentlichen Diskurs ausschließt, verliert an Legitimation – und produziert Radikalisierung, wo sie eigentlich Integration leisten sollte.“
Damit positioniert sich Patzelt nicht als Apologet der AfD, sondern als Analytiker eines gesellschaftlichen Prozesses, den viele lieber verdrängen. Der Autor geht daher auch scharf mit dem ins Gericht, was er den „pädagogischen Politikstil“ nennt: Entscheidungen werden von oben verkündet, abweichende Meinungen moralisch sanktioniert, Kritiker stigmatisiert.
Diese Praxis, so seine These, habe das Vertrauen in die repräsentative Demokratie tief erschüttert. In einem Interview mit der Tagespost warnte er: „Wenn dauerhaft nur noch Mitte-Links-Regierungen möglich sind, obwohl die Wählermehrheit in der Mitte oder rechts liegt, dann gerät das Prinzip der Volkssouveränität in Schieflage.“
Gekommen, um zu bleiben
Und wie sieht Patzelt die Zukunft der AfD? Er hält ihren weiteren Aufstieg für wahrscheinlich – nicht nur, weil sich die Partei immer weiter professionalisiere, sondern weil die Ursachen ihres Erfolgs nicht behoben wurden. Die großen Themen Migration, Energiepolitik und Meinungsfreiheit, so der Autor, seien weiterhin ungelöst oder werden ideologisch überdeckt.
Allerdings warnt er auch vor zu viel Selbstzufriedenheit innerhalb der AfD: Ohne strategische Neujustierung und politische Anschlussfähigkeit drohe ihr, sich in einer Radikalisierungsspirale zu verfangen. Patzelt plädiert daher für einen „konditionierten Dialog“ – also eine Gesprächsbereitschaft unter demokratischen Bedingungen. Man solle „nicht so tun, als wäre sie ein Fremdkörper in der Demokratie. Sie ist Teil einer Wählerschaft, die real existiert“, so Patzelt in einem Gespräch mit Polskie Radio.
In diesem Sinne versteht Patzelt sein Buch „Deutschlands blaues Wunder“ als Aufruf zur politischen Nüchternheit. Er wirbt für eine Rückkehr zur sachorientierten Auseinandersetzung – jenseits moralischer Aufgeregtheit. Die Demokratie, so sein Credo, müsse „die Fähigkeit zur Selbstkorrektur“ zurückgewinnen.
Dass ausgerechnet ein Wissenschaftler, der sich stets um Ausgleich und Verstehen bemüht hat, für seine Analysen angefeindet wurde, ist für Patzelt ein Symptom der Krise, die er beschreibt. Seine „blauen Wunder“ sind damit auch Spiegel einer Gesellschaft, die immer weniger bereit ist, Widerspruch zuzulassen.
Plädoyer für politische Vernunft
Patzelt argumentiert in „Deutschlands blaues Wunder“ mit der Präzision des Wissenschaftlers, aber auch mit der Leidenschaft des Bürgers, dem die Demokratie am Herzen liegt. Er zeigt: Die AfD ist kein Betriebsunfall, sondern ein Symptom. Wer sich ihr stellen will, muss die Ursachen angehen – nicht die Wähler beschimpfen.
Damit ist das Buch mehr als eine Studie über eine Partei. Es ist ein Plädoyer für die Wiedergewinnung politischer Vernunft, die in Deutschland vielerorts verloren gegangen scheint.
Echte Information statt Hetze: Wie die AfD zum relevanten politischen Faktor wurde – und warum sie weiter aufsteigen wird, erklärt Polit-Experte Werner Patzelt in seinem aktuellen Werk „Deutschlands blaues Wunder“. Analytisch, kritisch, faktenbasiert! Hier bestellen.