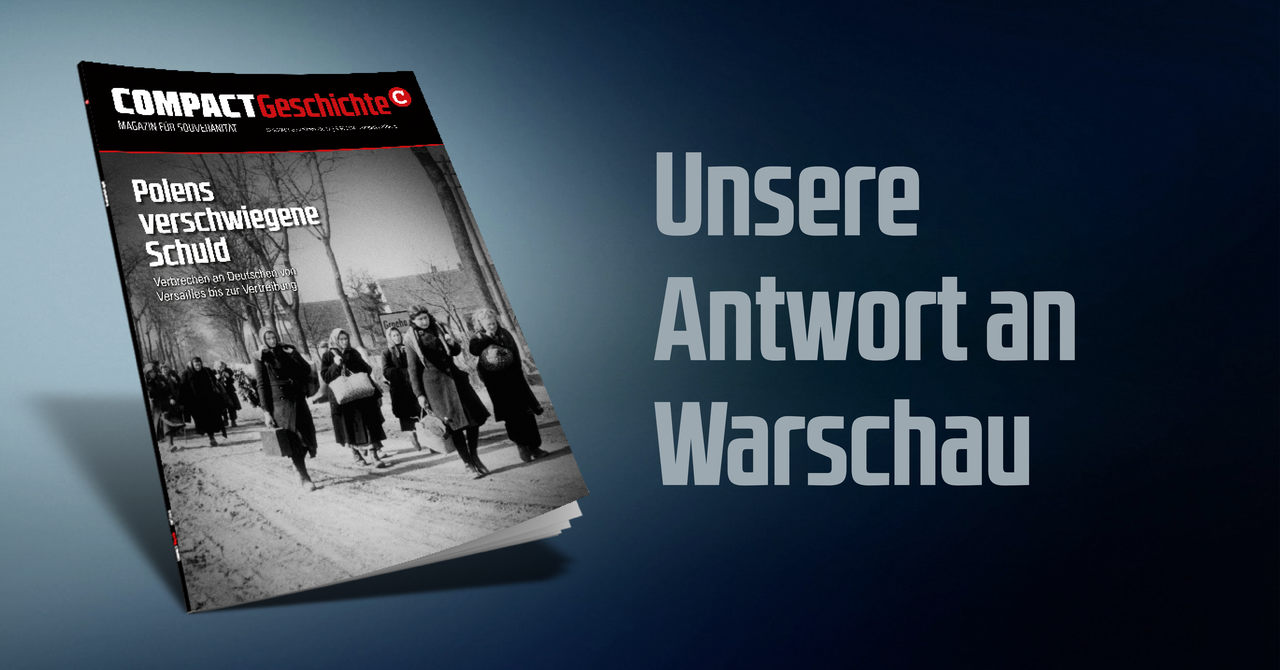Im Zuge der Wiedervereinigung bestätigte Deutschland die polnische Westgrenze – unter dem Druck der Siegermächte und vor dem Hintergrund schriller Töne aus Warschau. Dieser Artikel erschien in COMPACT-Geschichte «Polens verschwiegene Schuld». Unsere Antwort an Warschau. Hier mehr erfahren.
«Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung.» – Mit diesen markigen Worten unterstrich Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU) am 1. Juli 1989 auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover noch einmal die tatsächliche Rechtslage der Gebiete östlich von Oder und Neiße.
Unser Geschenk für Sie! COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“ würdigt große Ereignisse unserer Historie: Von Taufe Widukinds und der Krönung Karls des Großen bis zum Mauerfall Diese Ausgabe (84 Seiten, sonst 9,90 Euro) VERSCHENKEN wir an alle Kunden, die bis Dienstag (7. Oktober 2025, 24 Uhr) etwas in unserem Shop bestellen. Nutzen Sie die Gelegenheit: Decken Sie sich mit unseren Feuerzeugen, Magazinen, Spezial-Ausgaben, Medaillen, DVDs und anderen Produkten ein. Zu wirklich jeder Bestellung gibt es die GRATIS-Ausgabe obendrauf! Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk!
Tatsächlich hatten die DDR schon 1950 mit dem Görlitzer Abkommen und die Bundesrepublik im Rahmen des Warschauer Vertrages 1970 die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens akzeptiert, allerdings waren solche Verträge nur bindend, solange die betreffenden Teile Deutschlands nicht wiedervereinigt waren. Genau das sollte jedoch schon ein Jahr nach Waigels Rede passieren – jedenfalls in Bezug auf die BRD und die DDR. Doch wie mit jenen Gebieten verfahren, die seit Jahrzehnten unter polnischer Verwaltung standen und auf die in Sonntagsreden konservativer Politiker wie jener von Waigel in Hannover immer noch Anspruch erhoben wurde?

Kohl knickt ein
Bereits vor dem Fall der Berliner Mauer, am 27. September 1989, hatte der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) gegenüber seinem polnischen Amtskollegen Krzysztof Skubiszewski erklärt, dass man das Recht seines Volkes, «in sicheren Grenzen zu leben, (…) weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche» infrage stellen werde.
In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten Kanzler Helmut Kohl (CDU) und der polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki am 14. November 1989 in Warschau, dass «die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Achtung der territorialen Integrität und der Souveränität aller Staaten in Europa in ihren gegenwärtigen Grenzen eine grundlegende Bedingung für den Frieden sind».
In diesem Sinne ließ Kohl dann am 21. Juni 1990 in seiner Regierungserklärung anlässlich der Billigung des sogenannten Einheitsvertrages durch den Deutschen Bundestag und die DDR-Volkskammer die Hosen runter: Man werde die «Grenze Polens zu Deutschland, so wie sie heute verläuft», völkerrechtlich anerkennen. «Entweder wir bestätigen die bestehende Grenze, oder wir verspielen unsere Chance zur deutschen Einheit», so Kohl.
Was damit gemeint war, erläuterte der Bundeskanzler am 5. August 1990 mit einer an die Heimatvertriebenen gerichteten Aussage, wonach diese Bedingung «von der sowjetischen Seite einmal mehr mit allem Nachdruck bekräftigt» worden sei. «Ebenso unmissverständlich» wie Michail Gorbatschow hätten sich ihm gegenüber dazu auch «Präsident George Bush, Staatspräsident Mitterrand und Premierministerin Margaret Thatcher geäußert», so Kohl.
Von den vier Mächten, die «nach wie vor Träger von Rechten und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes» seien, hinge es davon ab, «ob das vereinte Deutschland volle Souveränität erlangt». Der «Durchbruch» in den Verhandlungen mit der Sowjetunion «wäre nie erreicht worden, wenn nicht unmissverständlich klar gewesen wäre, dass die Wiedervereinigung auf die Bundesrepublik, die DDR und Berlin beschränkt bleibt». Für diesen endgültigen Territorialverzicht erwartete Kohl allerdings im Gegenzug einen Verzicht auf sämtliche Reparationsansprüche gegen Deutschland.
Druck der Siegermächte
Die Preisgabe der Ostgebiete wurde also unter starkem Einfluss der Siegermächte vollzogen. Das hebt auch der Staatsrechtler Michael A. Hartenstein in seinem Buch «Die Geschichte der Oder-Neiße-Linie» hervor, wenn er schreibt:
«Dieser Druck lässt sich anhand einiger öffentlicher Aussagen führender westlicher Politiker zwischen dem Fall der Mauer und dem Abschluss der Zwei-plus-vier-Konferenz am 12. September 1990 mehrfach nachweisen. Die Regierung der Vereinigten Staaten ließ durch ihren Außenminister Baker klarstellen, dass sie von den gegenwärtigen Grenzen, innerhalb derer Deutschland sich vereinigen solle, ausgehe, und dass man sich an die Sprachregelung der ”Schlussakte von Helsinki” halten sollte, ”die davon ausgeht, dass die Grenzen in Europa unverletzlich sind und nur mit friedlichen Mitteln verändert werden sollten”. Dies war im Wesentlichen auch die Position der Regierung Großbritanniens. Frankreich ging über die Position der Vereinigten Staaten hinaus und verlangte über die Bestätigung der ”Unverletzlichkeit” der deutsch-polnischen Grenze eine Bestätigung der ”Unantastbarkeit” dieser Grenze, das heißt, ”dass man sie nicht mehr verändern kann”, eine Position, die gegenüber den Bestimmungen der von US-Außenminister Baker genannten Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Westeuropa von Helsinki von 1976 eine diskriminierende Sonderbehandlung für Deutschland vorsah.»
Mit dem Zwei-plus-vier-Vertrag – eigentlich Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland – vom 12. September 1990 wurde der Verzicht dann endgültig besiegelt. Man erklärte das Abkommen zudem als Ersatz für einen Friedensvertrag konventioneller Art, wie er in Potsdam 1945 vorgesehen war.
Gleich in Artikel 1 finden sich alle Elemente, die eine völkerrechtliche Bestätigung der bestehenden Grenzen Deutschlands, also auch der Oder-Neiße-Linie, vornehmen. Darin wird deren «endgültiger Charakter» als «wesentlicher Bestandteil der Friedensordnung in Europa» konstatiert. Die der Bundesrepublik und Polen in Artikel 1 Absatz 2 des Zwei-plus-vier-Vertrags auferlegte völkerrechtliche Fixierung der Grenze wurde schließlich mit dem deutsch-polnischen Grenzbestätigungsvertrag vom 14. November 1990 vollzogen.
Drohung aus Warschau
Der gesamte Wiedervereinigungsprozess wurde von Warschau mit schrillen Tönen begleitet. Den Höhepunkt bildete ein Interview der niederländischen Wochenzeitung Elsevier mit dem vormaligen Gewerkschaftsführer Lech Walesa vom März 1990. In dem Gespräch drohte der wenige Monate später zum polnischen Präsidenten gewählte Politiker der Bundesrepublik unverhohlen mit Massenvernichtungswaffen.
Walesa wörtlich:
«Und ich werde eine Äußerung machen, die mich in Deutschland nicht populär machen wird, aber ich schrecke nicht davor zurück: Falls die Deutschen von Neuem Instabilität in Europa verursachen sollten, in welcher Form auch immer, dann wird es in Zukunft nicht mehr zu einer Teilung Deutschlands kommen, sondern dann wird Deutschland von der Landkarte gefegt werden. Mit der fortgeschrittenen Technologie sind Ost und West gemeinsam imstande, dieses Urteil zu vollstrecken. Falls Deutschland nochmals beginnt, gibt es keine andere Lösung.»
Zwar stellte der Friedensnobelpreisträger von 1983 seine Äußerungen im Juli 1990 in einem Brief an den CSU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Zeitlmann als von ungenügender Präzision im Ausdruck infolge von Erschöpfung dar. Auch seien die Übersetzungen in mehrere Sprachen «nicht ohne Einfluss» auf Sinn und Klarheit seiner Worte gewesen. Doch ein bitterer Nachgeschmack bleibt – Walesa hat deutlich genug gezeigt, wes Geistes Kind er ist.
Zusätzlich zu dem einverleibten Viertel Deutschlands forderte Warschau nach 1990 auch weiterhin unter den verschiedensten Etiketten Zahlungen und Wiedergutmachungsleistungen von Deutschland. Seine Mitverantwortung für die Tragödien des 20. Jahrhunderts wird von Polen hingegen bis heute ausgeblendet – und den deutschen Politikern fehlt es an den notwendigen Kenntnissen, vor allem aber an Mut, den unverschämten Forderungen Warschaus überzeugend Paroli zu bieten.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass man auch in Berlin der These anhängt, dass die Deutschen stets Täter und die Polen stets Opfer waren. Doch kann man Menschen, die 1919 in die polnischen Lager Szczypiorno und Strzalkowo oder nach 1945 nach Lamsdorf, Schwientochlowitz und Jaworzno verschleppt wurden, wirklich als «Täter» abqualifizieren – und Menschenschinder wie Czeslaw Geborski oder Salomon Morel als «Opfer»? Wohl kaum.
Genau die richtigen Worte fand der US-Völkerrechtler und Historiker Alfred M. de Zayas, der dieser einseitigen Sichtweise in einer Rede vom 3. Juli 2005 einen rechtlich korrekten und humanen Standpunkt entgegengehalten hat:
«Es gab Opfer und Täter bei den Deutschen, wie es auch Opfer und Täter bei den Polen, den Tschechen, den Franzosen, den Briten und auch bei uns, den Amerikanern, gab. Uns verbinden nun ein gemeinsames europäisches Erbe, eine gemeinsame abendländische Geschichte und die gemeinsame Verpflichtung, die Menschenrechte zu achten und zu fördern.»
Die polnische Selbsteinschätzung, stets ein Hort abendländischer Gesinnung, ein Bollwerk gegen die Europa bedrohende Sowjetunion in den 1920er und 1930er Jahren, gegen das nationalsozialistische Deutschland Ende der 1930er Jahre gewesen zu sein, hat lange Jahre eine angemessene Würdigung der polnischen Politik vereitelt.
Keine Frage: Warschau hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es – auch unter massivem Gegenwind aus Brüssel – gewillt ist, seine Grenzen gegen illegale Einwanderung zu schützen, seine nationale Identität zu wahren, und es macht den Schwulen-, Lesben- und Gender-Spuk nicht mit. Das kann man Warschau nicht hoch genug anrechnen. Allerdings wird in Polen bis heute – mit Verweis auf die Opferrolle – eine Auseinandersetzung mit den eigenen Verbrechen und Untaten gescheut. Wäre dies anders, würde man keine horrenden Reparationsforderungen an den westlichen Nachbarn stellen.
Dieser Artikel erschien in COMPACT-Geschichte «Polens verschwiegene Schuld». Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung. Hier bestellen.