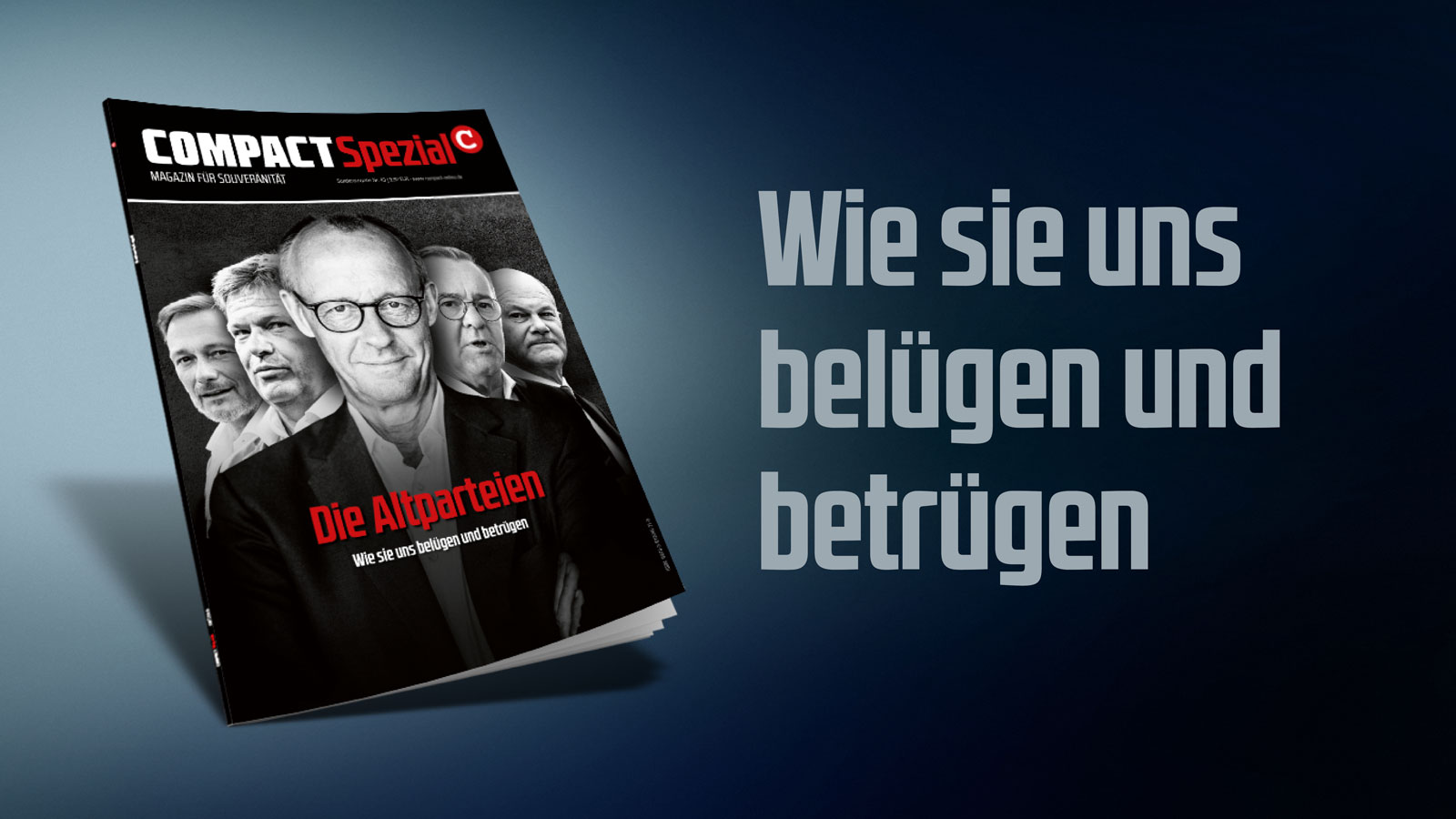Die AfD in Thüringen erzwingt einen Untersuchungsausschuss gegen den Verfassungsschutzchef des Landes, Stephan Kramer. Gegen den waren zuletzt massive Vorwürfe laut geworden. Das Zusammenwirken zwischen Geheimdienst und Politik spielt auch eine Rolle im neuen COMPACT-Spezial „Die Altparteien – Wie sie uns belügen und betrügen“. Hier mehr erfahren.
Die Angelegenheit ist pikant. Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke fasst zusammen: „In Zusammenhang mit der Person des Thüringer Verfassungsschutzchefs stehen Behördenmissbrauch, Gewaltandrohungen gegen Mitarbeiter und Geheimnisverrat im Raum.“ Die AfD wolle nun „diesen neuerlichen Geheimdienstskandal gründlich aufarbeiten“.
Auf eigene Faust gegen Andersdenkende
Stephan Kramer, seit 2015 Chef der Schlapphut-Behörde in Thüringen, soll sein Amt willkürlich und nach partei- und machtpolitischen Interessen geführt haben. Vorwürfe wie Geheimnisverrat und auch die Androhung körperlicher Gewalt gegen Mitarbeiter stehen im Raum.
Recherchen von Apollo News hatten ergeben, dass Kramer die AfD mit immer neuen Vorwürfen und Einstufungen attackierte, ohne seine Mitarbeiter in diese Prozesse einzubinden oder auch nur zu informieren. Stattdessen soll der frühere Chef des Zentralrats der Juden in Deutschland auf eigene Faust Akten gegen die AfD angelegt haben, die seine Untergebenen allenfalls mit Lachern quittiert hätten.
Letztlich sei es Kramer allein darum gegangen, die AfD zu bekämpfen. Vor den Landtagswahlen in Thüringen hatte er zur Frage einer möglichen AfD-Regierungsbeteiligung gesagt, dass er bis zum Wahltag „alles tun werde, um mich im Rahmen meiner gesetzlichen Möglichkeiten und Bürgerpflichten gegen diesen Extremismus-Angriff zur Wehr zu setzen“.
Ignorierte Vertraulichkeit
Der SPD-Mitglied wird darüber hinaus vorgeworfen, streng vertrauliche Informationen über innerdienstliche Spannungen im Amt für Verfassungsschutz weitergegeben zu haben. Dabei habe er sich mit Journalisten über Interna und unliebsame Mitarbeiter ausgetauscht.
Belastend sind in diesem Zusammenhang auch die Aufnahmen aus dem Jahr 2015, die Kramer mit russischen Rockern der „Nachtwölfe“ zeigten. Die „Putin-Rocker“ hatten den Sieg der Roten Armee über die Wehrmacht gefeiert. 2019 waren die Bilder an die Öffentlichkeit gelangt.
Als sich ein besorgter VS-Mitarbeiter 2018 vertrauensvoll an zwei WDR-Journalisten wandte, um auf die Missstände in der Geheimdienstbehörde aufmerksam zu machen, wurde er von diesen kurzerhand ans Messer geliefert. Sie verpetzten den Informanten bei Kramer; ein klarer Verstoß gegen den Quellenschutz des Pressekodex! Heute arbeitet dieser Mitarbeiter nicht mehr bei der Skandalbehörde…
Schräger Werdegang
Politisch gewütet hat Kramer eigentlich immer schon. Thilo Sarrazin warf er 2009 vor, mit „seinem Gedankengut Göring, Goebbels und Hitler große Ehre“ zu erweisen.
Und was seine fachliche Qualifikation angeht: Anders als es das Gesetz für die Besetzung der Stelle des Verfassungsschutzpräsidenten vorschreibt, ist Kramer weder Jurist noch Volkswirt, hat sein Jurastudium nie abgeschlossen. Als Beruf gibt er Sozialpädagoge an. Mit geheimdienstlichen Tätigkeiten hatte Kramer nie zuvor irgendetwas zu tun.
Auch der parteipolitische Werdegang des gebürtigen Westfalen ist schräg: 1984 trat er zunächst in die Junge Union und dann in die CDU ein, wechselte etwa zehn Jahre später zur FDP, 2010 schließlich zur SPD.
Bis heute mysteriös sind die Hintergründe eines Streits in Berlin im Jahre 2012. Damals will Kramer nach einem Synagogenbesuch auf der Straße von einem 30-Jährigen unfreundlich angesprochen worden sein („Geh doch dahin zurück, wo du hergekommen bist“). Kramer gab als Reaktion sogleich den Blick auf seine Pistole frei. Ein Augenzeuge alarmierte die Polizei. Die beiden Männer zeigten sich seinerzeit gegenseitig an, die Beamten bestätigten später Ermittlungen wegen „wechselseitiger Bedrohungen“. Die Sache verlief im Sande, allein die AfD hinterfragte, ob Kramer „seine Affekte im Griff“ habe.
Keine jüdischen Vorfahren
Geboren wurde Stephan J. Kramer 1968 in Siegen (Nordrhein-Westfalen). Das „J“ für „Joachim“ habe er in Erinnerung an seinen Großvater, der aus der Skatstadt Altenburg in Thüringen stammt, selbst seinem Namen hinzugefügt, erzählt er gern. Aufgewachsen ist er im Siegerland. Eine Reise in die USA habe ihn als 11-Jährigen nachhaltig geprägt. „Kramer gilt in den USA als ein jüdischer Name“, erinnerte er sich in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk im Sommer 2020. Fortan habe er sich zu diesem Glauben hingezogen gefühlt, obwohl er bei Nachforschungen auf keine eigenen jüdischen Vorfahren gestoßen sei.
Dennoch wurde er entsprechend aktiv, arbeitete ab 1995 für die Jewish Claims Conference, die Ansprüche von Holocaust-Opfern durchsetzt. Charlotte Knobloch, langjährige Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses, sei seine „jüdische Mammele“. Sie öffnete ihm weitere Türen, vermittelte beispielsweise einen Job bei Ignatz Bubis, von 1992 bis zu seinem Tod im Jahre 1999 Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Ende der 1990er Jahre trat Kramer dann dem mosaischen Glauben bei – ein Schritt, dem gewöhnlich eine etwa fünfjährige strenge Prüfungszeit vorausgeht, an deren Ende die Zustimmung eines Rabbinergerichts und die rituelle Beschneidung stehen.
„Rache der Linken“
Gleich anschließend startete Kramer dann durch: Schon 2004 war er Generalsekretär des Zentralrats und blieb dies bis 2014, ehe er im Zank ausschied. Er fiel allerdings weich. Kramer wechselte zum American Jewish Committee und wurde Direktor des europäischen Büros in Brüssel.
Zudem wirkte er verstärkt in der Jüdischen Gemeinde Berlin mit und stieg als Präsidiumsmitglied und Schatzmeister bei der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ein. Das dortige Engagement endete nach einem Jahr im Vorstandsstreit.
Der Konvertit ist zudem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und des Board of Governors des World Jewish Congress. Darüber hinaus sitzt er im Stiftungsrat der berüchtigten Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich im Kampf gegen rechts an Einseitigkeit nicht überbieten lässt. Dass ausgerechnet Kramer seit Jahren den Verfassungsschutz in Thüringen lenkt, sei ein „Personal-Coup“ von Bodo Ramelow, eine Art „verspätete Rache der Linken“, die „das Amt nie wirklich mochten“, spottete vor einiger Zeit die Welt am Sonntag.
Die enge Vernetzung von Parteipolitik und Geheidienst spielt auch eine Rolle im neuen COMPACT-Spezial „Die Altparteien – Wie sie uns belügen und betrügen“. Hier bestellen.