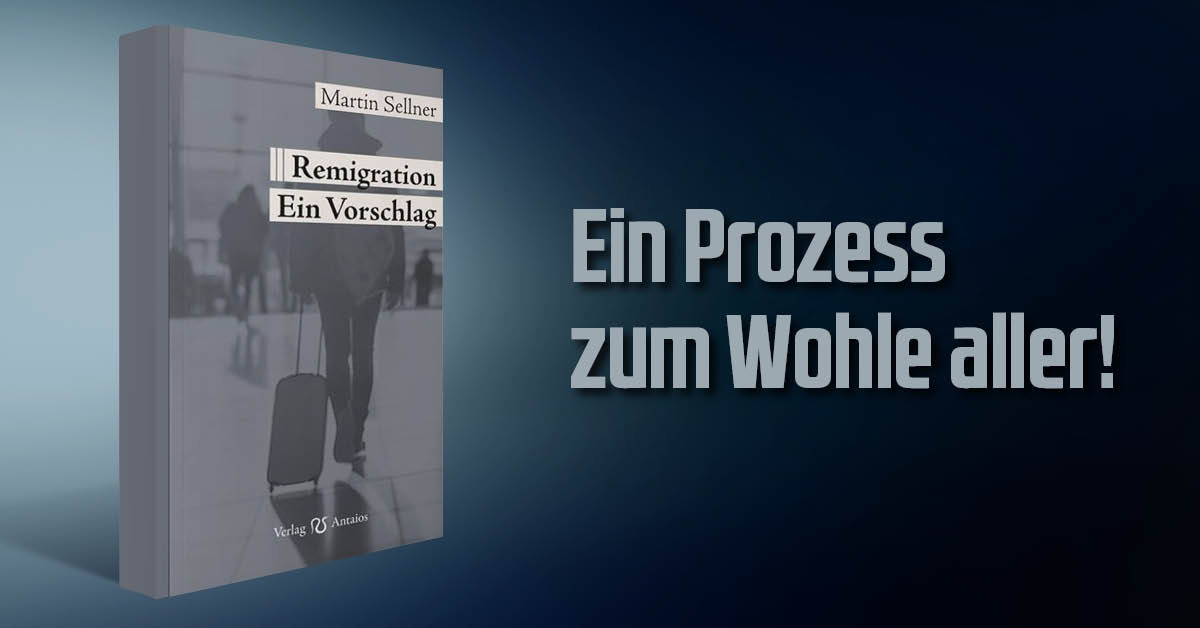Alexander Dobrindt lässt den Verein Muslim Interaktiv verbieten: Ein streng religiöses Netzwerk, getragen von Migranten, die mit muslimischem Pathos seit Jahren die Grenze zwischen Glauben und Ideologie verwischen. Ein Akt mit Gewicht, politisch inszeniert als entschlossener Kampf gegen islamistische Ideologien – doch hinter der eigentlich lobenswerten Handlung des Innenministeriums verbirgt sich mehr: ein Bedürfnis nach Kontrolle, das sich in die Pose der Stärke flüchtet – während der Staat seine Ohnmacht auf der Straße kaum noch verbergen kann. Was die Lösung für die Masseneinwanderung sein könnte, lesen Sie bei Martin Sellner: Remigration. Ein Vorschlag. Erfahren Sie mehr.
Noch vor Morgengrauen rückten Einsatzkräfte, unterstützt von Staatsschutz- und Bereitschaftseinheiten, deutschlandweit aus. In Hamburg, Berlin und Hessen brachen sie Türen auf, beschlagnahmten Computer, Telefone und Schriftmaterial. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden zudem Datenträger sowie handschriftliche Notizen sichergestellt, in einigen Objekten auch Vereinsunterlagen und Propagandamaterial. Die Aktion war Teil einer bundesweiten Maßnahme zur Vollstreckung des Vereinsverbots.

Digitaler Islamismus
Gegründet wurde die Gruppe im Frühjahr 2020 in Hamburg – unscheinbar, aus einem Kreis junger Männer, die sich als Verteidiger des „wahren Islams“ verstanden. Aus kleinen Versammlungen wurden bald professionelle Auftritte, aus Handykameras wurden Werkzeuge einer Bewegung.
Ihre Videos wirkten glatt und rhythmisch: religiöse Zitate, geschnitten mit Bildern von Kriegen, Ungerechtigkeit, Palästina und westlicher Dekadenz. Ein „Wir gegen Sie“ in Hochglanz. Das Kalifat als Vision, die Demokratie als Täuschung. Ihre Zielgruppe: junge Muslime, auf Identitätssuche zwischen Parallelgesellschaft und eigenem Heimatverlust.
Angeführt wurde die Bewegung von Asadullah Dandia, einem Hamburger Aktivisten, der sich selbst als Prediger und „Aufklärer“ verstand. In nahöstlichen Kulturkreisen hat der Begriff „Aufklärung“ eine etwas andere Bedeutung als in Europa. In langen Reden sprach er über Doppelmoral, Unterdrückung und den angeblich wahren Islam. Was nach intellektuellem Diskurs klang, war in Wahrheit geschickte Agitation: eine politische Botschaft, verpackt in religiöse Rhetorik. Brisant: Bereits im Frühjahr 2024 forderte die AfD-Bundestagsfraktion ein Verbotsverfahren – Merz und Dobrindt stimmten am 13.6.2024 dagegen.
Das Bundesinnenministerium sprach von einer Gruppierung, die „gegen die verfassungsmäßige Ordnung“ arbeite und das Existenzrecht Israels ablehne. Ob das Netzwerk die Existenzberechtigung der Deutschen in Deutschland ablehnt, schien kein Behördengrübeln zu verursachen. Der Gruppe wird eine geistige Nähe zur verbotenen Hizb ut-Tahrir nachgesagt, deren Ideologie von der Errichtung eines weltweiten Kalifats träumt.
Wie viele Anhänger das Netzwerk tatsächlich hatte, bleibt unklar. Manche Schätzungen sprechen von Zehntausenden, die ihre Inhalte regelmäßig sahen, andere von einem kleinen, aber harten Kern von Aktivisten. Gesichert ist nur: Sie waren sichtbar. Und sie verstanden das Spiel der Algorithmen besser als die meisten politischen Parteien.
Auf die Straße getragen
Was im Netz begann, fand bald den Weg auf die Straße: Muslim Interaktiv organisierte in den letzten Jahren mehrfach Kundgebungen – vor allem in Hamburg. Im Frühjahr 2024 versammelten sich nach Schätzungen der Behörden mehr als zweitausend Menschen unter ihren Fahnen – viele in traditionellen Gewändern, die Slogans riefen, in denen religiöse Frömmigkeit und politische Wut ineinanderflossen. Auch im Jahr zuvor hatte die Gruppe Demonstrationen mit rund elfhundert Teilnehmern organisiert, meist im Stadtteil St. Georg. Weitere Aufmärsche gab es in Berlin und Frankfurt, teils kleiner, aber ähnlich inszeniert.
Der Schein der Kontrolle
Am Vormittag nach den Razzien trat der Innenminister vor die Presse: „Wer auf unseren Straßen das Kalifat fordert und gegen Israel hetzt, dem begegnen wir mit aller rechtsstaatlichen Härte.“ Auch Hamburgs Innensenator Andy Grote lobte das Verbot als „Schlag gegen den modernen Tiktok-Islamismus“. Reaktionen aus dem Umfeld von Muslim Interaktiv gibt es bislang nicht.
Doch während die Politik Härte inszeniert, sprechen die Zahlen eine andere Sprache: Bis Mitte des Jahres 2025 wurden über 120.000 Asylanträge gestellt, die meisten davon unter 30 Jahre alt. Die Zahl der Personen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus steigt weiter. Gleichzeitig wächst das Gefühl eines schleichenden Souveränitätsverlustes im eigenen Land.
So wurde das Verbot von Muslim Interaktiv zum Ritual staatlicher Selbstvergewisserung: ein sichtbarer Akt gegen einen sichtbaren Gegner – während die eigentliche Ursache fortbesteht. „Man kann einen Verein verbieten,“ sagt der Extremismusforscher Ahmad Mansour, „aber nicht die Idee, die ihn trägt“. Das Verbot war richtig, aber es war auch bequem. Ein sauberer Schnitt für die Kameras – in einem Land, das längst spürt, dass die Wurzeln des Problems tiefer reichen als jede Hausdurchsuchung.
Die jungen Migranten, die sich von solchen Ideologien angezogen fühlen, werden sich auch morgen dieselben Fragen stellen: Wer bin ich hier? Wo gehöre ich hin? Ist der Islam die Zukunft? Antworten finden Sie bei Martin Sellner: Remigration. Ein Vorschlag. Lesen Sie hier.