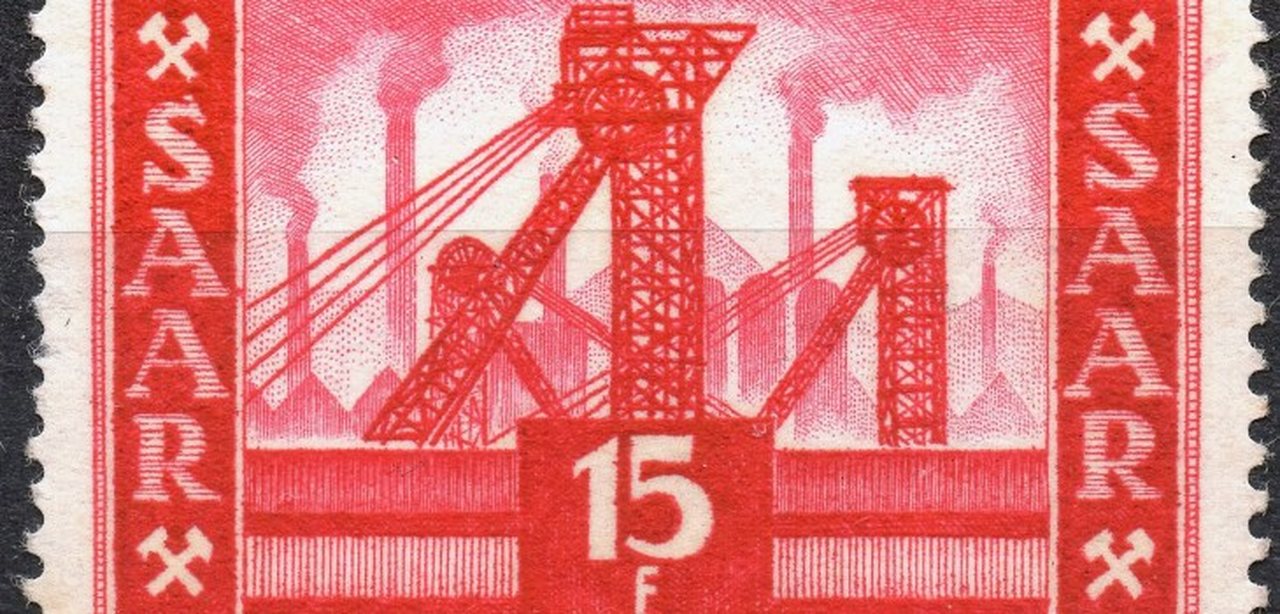Heute vor 70 Jahren schlug an der Saar eine deutsche Stunde: Die schicksalhafte Volksabstimmung stand an, von der so viel abhing. Es ging gut! Wer Erinnerungen an solche Meilensteine unserer Geschichte gebündelt lesen mag, der greift zu unserer Sonderausgabe „Schicksalstage der Deutschen – Von Karl dem Großen bis zum Fall der Mauer“. Hier mehr erfahren.
Am 23. Oktober 1955 fand an der Saar eine wegweisende Abstimmung statt. Es musste sich entscheiden, ob nationale Solidarität über fremden Imperialismus, heimischen Separatismus und volksvergessene Europatümelei siegen würde. 663.970 Stimmberechtigte waren aufgerufen, mit Ja oder Nein folgende Frage zu beantworten:
„Billigen Sie das zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik vereinbarte Status für das Saarland?“
Obwohl sich die Separatisten bemühten, den wahren Sachverhalt hinter einem Schwall von Euro-Parolen zu verbergen, war Deutschbewussten klar, was ein Ja zum Statut bedeutet hätte: Endgültige Abtrennung des Saargebiets von Deutschland.
Propaganda der Gegenseite
Mit großem Einsatz versuchten Separatisten, Frankophile und Euro-Schwärmer, den Deutschen an der Saar das Statut anzupreisen. Nicht zuletzt lockte man mit materiellen Verheißungen.
Ein europäisiertes Saarland werde ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung nehmen, hieß es, denn dann würden sich Paris und Bonn sowie die Gemeinschaft europäischer Staaten für das Erblühen der Region stark machen. Ein Nein jedoch bedeute den „Rückfall an reaktionäres nationalstaatliches Denken“. Es wurden damals schon all jene Parolen heruntergebetet, die später auch vom Streben nach Wiedervereinigung wegführen sollten.
Die Wahlbeteiligung betrug annähernd 97 Prozent, was den hohen Grad der Politisierung der Saarbevölkerung aufzeigte. Dann wurde das mit Spannung erwartete Ergebnis bekanntgegeben: 423.655, also 67,7 Prozent, hatten sich nicht blenden lassen und das Saarstatur abgelehnt. Das war eine klare Zweidrittelmehrheit für die Wiedervereinigung mit Deutschland. Nach 1935 hatten sich die Deutschen an der Saar zum zweiten Mal mit überwältigender Mehrheit zum deutschen Vaterland bekannt.
Es kam zum Anschluss des Saargebietes an die Bundesrepublik Deutschland. Eine weitere deutsche Trennungsgrenze der mittelbaren Nachkriegszeit war überwunden. Paris fügte sich in den Willen der Saarbevölkerung, ließ sich aber den Vollzug des Selbstbestimmungsgesetzes teuer bezahlen.
Was sich Frankreich herausnahm
Frankreich behielt sich beispielsweise das Recht vor, binnen 25 Jahren 66 Millionen Tonnen Kohle von Lothringen aus abzubauen; in Schächten, die unter der Grenze hindurch ins Saarland hineinreichten. Ferner musste Deutschland die Kosten der Schiffbarmachung der Mosel, weitgehend zu Frankreichs Nutze, übernehmen.
Auf deutsche Kosten ging auch der Ausbau des Oberrheins zwischen Breisach und Straßburg sowie des auf französischem Staatsgebiet verlaufenden Rheinlandkanals. Mehr noch: Die Bundesrepublik hatte auf Beteiligung am Gewinn aus der Elektrizitätserzeugung am Oberrhein zu verzichten. Außerdem wurden die drei Delegierten des Saarlandes in der Montanunion durch Vertreter Frankreichs ersetzt.
Zu einer von den Gegnern der Wiedervereinigung vorausgesagte wirtschaftliche Zerrüttung an der Saar aber kam es nicht. Die Zukunft erwies, dass das Saargebiet mit der Entscheidung für Deutschland auch ökonomisch die bessere Wahl getroffen hatte. Dank deutschem Fleiß und Organisationsgeschick gelang die weitgehend reibungslose Eingliederung des ein Jahrzehnt lang fremdgesetzt gewesenen Staatsgebiets.
Wer Erinnerungen an solche Meilensteine unserer Geschichte gebündelt lesen mag, der greift zu unserer Sonderausgabe „Schicksalstag der Deutschen – Von Karl dem Großen bis zum Fall der Mauer“. Hier bestellen.